Von Elenora Bolter: Vertreibung, Neuanfang und Wiedersehen mit Jägerndorf

50 Jahre nach der Vertreibung
Tatsachenbericht von Eleonora Bolter, geborene Schwella
(Die Karten und Farbfotos sind Beifügungen von Lorenz Loserth)
Inhaltsverzeichnis
- Die Kindheit
- Vertreibung aus der Wohnung - Türmitzer Lager
- Das gefürchtete Troppauer Lager
- Im Hause des Geschäftsmannes Slovaček
- Das Aussiedlerlager am Burgberg
- Der Transport in Viehwaggons
- Einweisung der Vertriebenen: Endsee
- Schulzeit in Ansbach/Mfr.
- Die Familie ist vereint - Nürnberg
- Eine neue Existenz wird aufgebaut
- Wiedersehen mit der Geburtsstadt Jägerndorf
- Schlußbemerkungen
Die Kindheit
Das Erinnerungsvermögen an meine frühe Kindheit geht in etwa bis zu meinem 4. Lebensjahr zurück. Die damalige Zeit kann man nicht gerade als „rosig“ bezeichnen, doch bestanden berechtigte Hoffnungen auf eine bessere Zukunft. Ich wurde 1934 in Jägerndorf (Ostsudetenland) geboren. Da meine Eltern noch sehr jung und beide berufstätig waren, verbrachte ich die Jahre bis zum Schuleintritt meist bei fremden Menschen. Während meiner ersten zwei Lebensjahre hatte es meine Mutter besonders schwer. Schon morgens kurz nach 5.00 Uhr mußte sie mich aus dem Schlaf reißen, in den Kinderwagen packen und zur Krippe bringen, wo ich wieder in ein Bett gelegt wurde und weiterschlafen konnte. Nach der Arbeit holte mich Mutter wieder ab. Daß sie diesen Weg jeweils zu Fuß zurücklegen mußte, versteht sich von selbst. Zur damaligen Zeit gab es, insbesondere in kleineren Orten, noch kein ausgebautes Verkehrsnetz. Kilometerweite Fußmärsche zu den Arbeitsstätten, zur Schule oder zu Besuchen bei Verwandten und Bekannten waren an der Tagesordnung. Glücklich schätzte sich derjenige, der ein Fahrrad sein eigen nannte. Über Autos verfügten in der Regel nur höhergestellte Persönlichkeiten sowie Ärzte und Geschäftsleute.
Eine intensivere Erinnerung habe ich an all die sogenannten Tagesmütter, denen ich bis zu meinem 6. Lebensjahr anvertraut und ebenfalls schon morgens in aller Frühe übergeben wurde. Offensichtlich war es für meine Mutter nicht immer einfach, geeignete und willige Menschen zu finden, die bereit waren, Verantwortung für ein fremdes Kind zu übernehmen, auch wenn sie dafür entlohnt wurden. Mehrmals mußte ich mich an andere Aufpasser und an eine neue Umgebung gewöhnen. In besonderer Erinnerung sind mir die beiden armen alten Menschen geblieben, die mich über einen langen Zeitraum hinweg betreuten. Sie hausten in einem einzigen Stübchen, das von der Straße aus zu betreten war. Es roch immer nach Petroleum, denn elektrischen Strom gab es in dieser Behausung nicht. Manchmal wurde sogar dieses trübe Licht gelöscht, denn man mußte sparen. Meine Anwesenheit brachte den Leuten ein kleines Zubrot. Es war ein sehr bescheidenes Dasein, aber ich wurde gut behandelt.
Langeweile kam bei mir nie auf, auch wenn die Erwachsenen sich nicht mit mir beschäftigten. Als Kind jener Zeit hatte ich kaum Ansprüche. Ich war mit dem zufrieden, was ich erhielt. Damals mäkelte man weder am Essen noch an den Spielsachen herum. Ein Kind war froh, wenn es überhaupt etwas bekam. Ich beschäftigte mich mit meinem Kreisel, den ich immer wieder tanzen ließ, mit Malbüchern, Ausschneidepuppen, Bausteinen und dergleichen. Obwohl meine ersten Kindheitsjahre in großer Bescheidenheit verliefen, habe ich nichts vermißt und ich denke gerne daran zurück.
Ich war kein Musterkind. Trotzreaktionen und Ungehorsam brachten meine Hüter manchmal zur Verzweiflung. Meine kindlichen Wünsche allerdings hielten sich in Grenzen, dafür hatte meine Mutter, die als Waise in einem Heim aufgewachsen war, durch Überzeugungsarbeit gesorgt.
Selbstverständlich waren die Tage, an denen die Eltern Zeit hatten, für mich die schönsten. Vater wanderte gerne und so blieb es nicht aus, daß wir am Sonntag kilometerweite Märsche in die nähere und weitere Umgebung unternahmen. Ich marschierte tapfer mit, denn am Ziel lockte in der Regel eine frische Limonade, manchmal auch ein Eis.
Durch meine ständigen Aufenthalte bei fremden Menschen hatte ich jegliche Scheu verloren und lief mit jedem mit, der mich ansprach - sehr zur Sorge meiner Mutter. Als Mutter einmal mit Einkäufen beschäftigt war und ich vor dem Laden wartete, muß ich durch mein kindliches und immer gewinnendes Lächeln wohl einen gewissen Eindruck auf eine vornehme Dame gemacht haben, denn ich wurde wieder einmal zum Mitkommen aufgefordert, diesmal allerdings erst, nachdem meine Mutter gefragt worden war und sie eingewilligt hatte. Es handelte sich um ein in der Nähe der Nikolausstraße wohnendes Paar, dessen Ehe kinderlos geblieben war. Der Gatte, ein mit Tuchen handelnder Geschäftsmann, hatte offensichtlich nichts gegen meinen Besuch in seinem Hause. Im Gegenteil, meine Mutter wurde häufig gebeten, mich ihnen doch für einige Tage zu überlassen. Da es sich um begüterte Geschäftsleute handelte, wurde ich mit gutem Essen und kleinen Geschenken verwöhnt. Sie kleideten mich ihrem Geschmack entsprechend ein, spielten mit mir und behandelten mich wie ihr eigenes Kind. Da mir sogar ein eigenes Zimmer zur Verfügung stand, was ich zu Hause nicht hatte, freute ich mich über jede Einladung zum längeren Verbleib. Der Herr des Hauses unterbreitete - trotz meines damals noch kindlichen Alters - meiner Mutter das Angebot, mich später in seinem Betrieb ausbilden und dort arbeiten zu lassen. Für meine berufliche Zukunft war also bereits gesorgt, als ich noch nicht einmal die Schule besuchte. Ob ich dieses Angebot letztendlich angenommen hätte, bleibt dahingestellt. Meine Ambitionen liefen - wie sich später herausstellte - in eine andere Richtung.
Doch es kam alles anders. Die Zeiten änderten sich, der Krieg brach aus. Die Zukunftsträume der meisten Menschen zerrannen im Nichts.
Der Tag meiner Einschulung rückte näher. Mein Vater hatte sich in der Zwischenzeit beruflich und finanziell verbessern können, so daß meine Mutter zum Zeitpunkt meines Schuleintritts ihre Arbeit aufgab. Von Stund an stand ich unter ihrer Obhut. Ihre eigene Kindheit im Waisenhaus hatte sie geprägt. Sie war streng und ohne große Zuwendungen erzogen worden. Nur das, was ihr als Kind an Liebe zuteil geworden war, vermochte sie an ihre Kinder weiterzugeben. Dementsprechend rauh war ihr Umgang mit mir, was nicht bedeutete, daß sie herzlos gewesen wäre. Sie zeigte nur selten ihre wahren Gefühle, ihre innere Einstellung also, die sich auch auf mich übertrug. Zum besseren Verständnis für die Auswirkungen dieses ständig unterdrückten Gefühlslebens, welches unsere Familie möglicherweise nach außen hin hart und unnahbar erscheinen ließ, möchte ich hier einige bezeichnende Beispiele anführen.
Meinen ersten Schultag in der Jubiläumsschule werde ich daher nie vergessen. Ebenso wie die anderen Kinder, wurde ich an diesem Tage von meiner Mutter begleitet. Während die anderen Mütter ihre Kinder küßten und liebkosten, bevor diese zum erstenmal ihr Klassenzimmer aufsuchten, drückte mir Mutter lediglich die Schultasche in die Hand und ermahnte mich, brav zu sein. Sie wolle zusammen mit den anderen Frauen draußen auf mich warten. Im Klassenzimmer angekommen, setzte ich mich auf den mir zugewiesenen Platz. Aufmerksam folgte ich den Worten und Erklärungen der Lehrerin. Aber das Bild der Mütter, die ihre Kinder geküßt hatten, ging mir nicht aus dem Sinn. Erst da wurde mir bewußt, daß ich bisher von meiner Mutter kaum in den Arm genommen oder geküßt worden war, zumindest waren mir solche Zärtlichkeiten nicht erinnerlich. Der Anblick einer Mutter, die ihr Kind auf der Straße küßte, war mir fremd und peinlich zugleich, dennoch regte sich in mir der Wunsch, gleichermaßen liebevoll behandelt zu werden.
Der erste Unterricht endete schon nach einer knappen Stunde. Die Mütter nahmen ihre Kinder wieder in Empfang. Auch meine Mutter hatte gewartet. Die Frage, warum fast alle anderen Kinder von ihren Müttern geküßt worden waren und warum das bei uns nicht üblich ist, brannte mir zwar auf der Seele, aber ich wagte nicht, sie auszusprechen. Gefühl und Konvention standen im Widerstreit.
Die Schule bereitete mir Freude, ich lernte gut und brachte in allen Zeugnissen nur Einser nach Hause. Da meine Eltern in ihren Erziehungsmethoden sehr streng waren, hatte ich einfach zu lernen und gehorsam zu sein. Wenn sich - wie so oft - mein Trotz durchsetzen wollte, bezog ich von beiden Prügel. Damals wandten die Eltern andere Erziehungsmethoden an als heute. Hin und wieder kam es allerdings auch vor, daß ich von einem Elternteil in Schutz genommen wurde. Dann wiederum hatte ich ein schlechtes Gewissen, denn ich glaubte, daß damit entweder meiner Mutter oder meinem Vater Unrecht getan wird. Meine kindliche Seele zog es vor, entweder von beiden bestraft oder von beiden gelobt zu werden. Besonders harte Strafen verordnete mir jedoch meine Mutter, denn mit ihr war ich die meiste Zeit zusammen. Sie wandte offensichtlich die Strafmittel an, die sie aus ihrer eigenen Kindheit her kannte. Dazu gehörte das Knien auf Holzscheiten oder harten Erbsen. Die Bitte um Verzeihung nach einem Ungehorsam hätte meiner Qual sofort ein Ende bereitet. Doch zu meinen negativen Charaktereigenschaften gehörten Trotz und Verstocktheit. Auch wenn die scharfen Holzscheite noch so tiefe Rillen in Knie und Schienbein drückten, ich blieb in meiner Ecke. Irgendwann wurde es dann meiner Mutter zuviel oder sie hatte mit mir Erbarmen und erlöste mich von der Pein.
Ein anderes Ereignis, das wiederum mit Körperkontakt verbunden war, hat sich bis heute in meinem Gedächtnis eingeprägt. Während einer Religionsstunde im ersten Schuljahr wurden wir daran erinnert, daß am nächsten Tage Aschermittwoch sei. Bevor wir am Morgen das Haus verlassen, sollten wir uns von unseren Müttern ein Aschenkreuz auf die Stirne zeichnen lassen. Der Gedanke, meine Mutter um das Aschenkreuz bitten zu müssen, beunruhigte mich bereits am Abend vorher und ließ mich nachts kaum Schlaf finden. Am nächsten Morgen trödelte ich dermaßen herum, daß Mutter schon unwillig wurde, weil sie befürchtete, ich könne zu spät zur Schule kommen. Mein ständiges Verzögern war jedoch die Angst, nun doch den Wunsch nach dem Aschenkreuz aussprechen zu müssen. Alle würden das Zeichen auf der Stirn haben, ich wollte es auch. Und außerdem hatte ich die Worte des Religionslehrers als einen Befehl aufgefaßt. Aber dazu war es erforderlich, eine Berührung meiner Mutter zu verlangen, und davor hatte ich Scheu. Ich spüre noch heute die innere Zerrissenheit. Da war der Wunsch nach dem Kreuz und gleichzeitig die Peinlichkeit, eine Berührung erbitten und über mich ergehen lassen zu müssen. Es wurde immer später, ich mußte mich durchringen. Ich nahm allen Mut zusammen und sagte meiner Mutter, daß ich ein Aschenkreuz auf der Stirne benötige, sonst könne ich heute nicht in die Schule gehen. Mutter schaute mich an. Asche war in allen Haushalten vorhanden, da seinerzeit überall mit Kohle geheizt wurde. Sie tauchte einen Finger in den Ascheneimer, malte mir wortlos aber hastig ein Kreuz auf die Stirn und schob mich nach draußen.

Sehr früh hatte ich auch für die Ordnung und Instandhaltung meiner eigenen Kleidung zu sorgen. Dazu gehörten das Strümpfestopfen und das Knöpfeannähen. Ersteres gelang mir im Laufe der Zeit in einer Perfektion, daß ich einer Kunststopferin hätte Konkurrenz machen können. Zur damaligen Zeit wurden die Kinder schon in jungen Jahren zur Arbeit und zu einer gewissen Selbständigkeit angehalten.
Wenn ich Wünsche äußerte, betrafen diese in der Regel weniger materielle Dinge an sich, sondern allenfalls noch zu erlernende Aktivitäten.
Viel Freude und Spaß bereitete mir das Schlittschuhlaufen. Zwar waren meine ersten Versuche mit sehr vielen Stürzen verbunden, aber die Aussicht, einmal mit weißen Schuhen kunstlaufen zu können, ließ mich ständig neue Versuche starten. Ich entwickelte für diesen Sport großes Talent. Am liebsten wäre ich jeden Wintertag aufs Eis gegangen, hätte mir meine Mutter nicht klargemacht, daß dafür auch Eintrittsgeld erforderlich ist. Was das Kunstlaufen anbelangt, so hätte auch dies ein finanzielles Opfer für meine Eltern bedeutet, denn ein Ausbilder war erforderlich, Trainingsstunden hätten bezahlt werden müssen. Ich wurde auf später vertröstet, auf eine Zeit, in der es meinen Eltern mit Sicherheit besser gehen würde.
Als begeisterter Sportler, Schwimmer und Skifahrer versuchte mein Vater selbstverständlich, auch mein Interesse für diese Gebiete zu wecken. Der Kauf von Skiern erwies sich allerdings als Fehler, denn ich saß mehr auf den Brettern, als ich darauf zu stehen in der Lage war. So mancher Baum oder Strauch hatte meine kleine Abfahrt gestoppt. Dies war wohl die erste Enttäuschung für Vater, der sich schon gemeinsam mit mir an den Hängen des Altvaters gesehen hatte.
Mein größter Wunsch war der eines eigenen Akkordeons und spielen lernen zu dürfen. Es verging kein Tag, an welchem ich meinen Eltern nicht von einem Akkordeon vorschwärmte. Trotz des täglichen Bettelns und der vielen Tränen, die ich dieserhalb vergoß, konnte mir dieser Wunsch nicht erfüllt werden, denn in der Zwischenzeit war der Krieg ausgebrochen. Niemand wußte, wie lange er dauern, wie er enden würde. Jeder hoffte auf bessere Zeiten. Vater hatte sich hochgearbeitet. Es ging uns finanziell wesentlich besser als früher, dennoch waren andere Dinge vorrangig. Meine Eltern tätigten größere Anschaffungen. Sie richteten sich eine neue Wohnung ein. Vater komplettierte seine Fotoausrüstung, wozu sämtliche Utensilien für eigene Entwicklungen und Vergrößerungen gehörten. Das Fotografieren war mit eines seiner hobbies.
Als kleine Entschädigung für das immer noch nicht angeschaffte Akkordeon durfte ich das sogenannte Freiturnen in einem der Schulgebäude im Park besuchen, also zusätzliche Turnstunden außerhalb des normalen Schulturnens nehmen. Ich turnte gerne und ließ keine Stunde ausfallen. Zu meinen Lieblingsbeschäftigungen gehörte neben dem Schwimmen, was ich außer im Jägerndorfer Freibad gerne in dem Fluß Oppa ausübte, auch das Lesen. Ich hütete jedes meiner Bücher wie einen kostbaren Schatz. Alles andere hätte ich jemandem geliehen, niemals jedoch ein Buch. Mein kleiner kindlicher Reichtum mehrte sich nicht nur in Form von Büchern oder Puppen, sondern auch bei der Jägerndorfer Sparkasse. Voller Stolz trug ich jeweils die gefüllte Sparbüchse zum Schalter, ließ sie dort öffnen, die Groschen zählen und im Sparbuch nachtragen. Auch wenn Krieg herrschte, so trat in unserer Familie dennoch ein gewisser Wohlstand ein. Die schwierigen Anfangsjahre, die mit der Gründung des Hausstandes meiner jungen Eltern zusammenhingen, waren überwunden. Das Geld für meine Betreuung durch fremde Menschen konnte gespart werden. Meine Eltern hatten daher eine gewisse Vorstellung von ihrer und meiner Zukunft. Aufgrund meiner guten Zeugnisse stand auch fest, daß ich später eine höhere Schule besuchen, möglicherweise auch studieren würde. Mein Leben sollte anders, besser verlaufen als das ihre.

In der Zwischenzeit hatte ich einen Bruder bekommen, dem nun mehr Aufmerksamkeit gewidmet wurde. Der Familienzuwachs änderte kaum etwas in meinem Leben. Unsere Ausflüge an den Wochenenden führten wir nach wie vor durch, nun eben mit Kinderwagen. Es hätte alles so schön bleiben können, wäre der Krieg nicht grausamer und intensiver geworden. Vater wurde zum Militär eingezogen. Verstärkte Bombenangriffe zwangen uns immer häufiger in den Luftschutzkeller des Hauses. Verdunkelungsgebot, Ausgangssperre, Mangel an Nahrungsmitteln und die Sorge um das Ergehen unseres Vaters erschwerten das Leben.Die feindlichen Truppen näherten sich von Osten. Man hörte von Greueltaten der Russen. Besonders gefürchtet waren die Mongolen. Eine Freundin meiner Mutter hatte Verwandte in Würbenthal, die bereit waren, uns für einige Zeit aufzunehmen. Angeblich sollte man dort zunächst noch vor den Russen sicher sein. Mutter packte einige Sachen zusammen und wir machten uns auf den Weg nach Würbenthal, wo wir im Hause jener Verwandten ein Zimmer zugewiesen bekamen. In der Tat, während der ersten Wochen verlief unser Leben dort verhältnismäßig ruhig. Doch immer häufiger wurden Luftangriffe geflogen, und eines Tages entging ich nur knapp dem Geschoß einer Bordkanone. Ich hatte, wie so oft, mit anderen Kindern im Hof gespielt, als ein Flugzeug im Niedrigflug über uns hinwegdonnerte. Gleichzeitig pfiff ein Gegenstand unmittelbar an meinem Kopf vorbei und schlug nur wenige Meter entfernt in die Erde. Nach diesem Erlebnis war es für uns Kinder mit dem unbekümmerten Spielen im Freien zu Ende. Wir hatten von Stund an auf Flugzeuge und Geschoßsalven zu achten und durften uns kaum noch von der Häuserwand entfernen. Es blieb jedoch nicht nur bei diesen Gefahren. Daß die Russen innerhalb kurzer Zeit auch diese Gegend erreicht haben würden, damit hatte niemand gerechnet.
Eines Morgens lief die Kunde durch den Ort, die Russen seien einmarschiert. Der größte Teil davon befände sich in einem Spirituosenlager, total betrunken. Was sich Stunden später auf den Straßen abgespielt haben muß, bekam ich nur bruchstückweise mit und habe es zum größten Teil auch nicht verstanden. Ich war noch Kind und dazu unaufgeklärt. Da war von Besenstielen die Rede, welche man den Frauen in den Leib gerammt haben soll, von Unkeuschheiten, die mit Worten nicht zu beschreiben seien, von verübten Grausamkeiten sowohl Männern als auch alten Frauen gegenüber. Randalierend, grölend, raubend und mordend sollen betrunkene Mongolen durch den Ort gezogen sein.
Mit Unverständnis, Entsetzen und Angst nahm ich die Erzählungen der Erwachsenen auf. Ich verstand viele Zusammenhänge nicht, wagte aber nicht, meine Mutter danach zu fragen. Natürlich tat sich auch das eine oder andere Kind mit irgendwelchen Schilderungen von Ereignissen hervor. Auf meine gezielten Fragen konnte ich aber auch da keine Antwort erhalten. Zur damaligen Zeit wägten die Erwachsenen ihre Worte und Erläuterungen den Kindern gegenüber genau ab. Wir Kinder wären besser beraten gewesen, hätte man uns wenigstens ein wenig und kindgerecht aufgeklärt. Doch gewisse Themen waren eben tabu. Man wurde weggeschickt, wenn Erwachsene sich unterhielten, denn ihrer Ansicht nach war nicht alles für die „Ohren der Kinder“ bestimmt.
Eines Nachts - meine Mutter schlief mit meinem kleinen Bruder zusammen in einem, ich in dem anderen Bett - pochte es an die Zimmertür und Stimmen von Russen wurden laut. Mutter, nur mit dem Nachthemd bekleidet, öffnete. Mehrere Russen traten ein und musterten zunächst meine Mutter und mich. Dann fiel ihr Blick auf das in einer Ecke stehende alte Fahrrad. Obwohl sie damit nicht umzugehen wußten - man sah es an der Art, wie sie die Pedalen betrachteten und mit der Hand bewegten, wie sie versuchten, die Lenkstange um die eigene Achse zu drehen - bemächtigten sie sich des Rades. Dann entdeckten sie auch noch Mutters Wecker und Armbanduhr. Kindliche Freude zeigte sich in ihren Gesichtern. Sie steckten die Gegenstände in die Tasche. Doch dann wandten sie mir ihre Aufmerksamkeit zu. Ich hatte mich, als sie eintraten, im Bett hochgesetzt. Meine Mutter versuchte, mir klarzumachen, daß es besser sei, wenn ich wieder unter die Decke kröche. Ich verstand aber nicht, warum ich das sollte. Dann deutete einer der Russen auf mich mit der Frage nach meinem Alter. Ich antwortete spontan und wahrheitsgemäß. Meine Mutter erblaßte und sagte, ich sei noch keine 8 Jahre alt. Ich widersprach ihr und nannte erneut mein wahres Alter. Doch offensichtlich hatten das Fahrrad und die beiden Uhren mehr Eindruck auf diese Männer gemacht als ich. Auch meine Mutter schien für sie nicht mehr interessant zu sein. Sie taxierten sie zwar, aber dann verließen sie freudestrahlend mit ihrer Beute den Raum. Mutter fiel erschöpft in ihre Kissen zurück.
Nach dem Erlebnis dieser Nacht ließ man mich nicht mehr zu Hause im Bett schlafen. Mutter, die für meinen kleinen Bruder zu sorgen hatte, blieb selbstverständlich im Hause. Aber alle Mädchen ab ca. 6 Jahren wurden abends mit einer Decke oder einem alten Mantel ausgestattet und in ein Sägewerk begleitet. Dort mußten wir unter die Bretterstöße kriechen und die Nächte im Freien verbringen. Niemand von uns durfte seinen Schlafplatz verlassen. Am nächsten Morgen holte uns dann irgendeine Mutter wieder ab. Keinem von uns Kindern war klar, weshalb wir hier draußen in der Kälte nächtigen mußten. Die Mütter hatten auf unsere Fragen immer ausweichende Antworten.
Nachdem nun die Russen bis Würbenthal vorgedrungen und wir dort ebenso gefährdet waren wie andernorts auch, bestand keine Veranlassung mehr, die Gastfreundschaft dieser Menschen weiter in Anspruch zu nehmen. Wir kehrten wieder nach Jägerndorf zurück.
Die Straßen der Stadt waren an vielen Stellen durch Panzersperren blockiert. Überall herrschte Chaos. Freunde und Bekannte suchten anderweitig Schutz und Hilfe. Ich hatte schon seit längerer Zeit keinen Schulunterricht mehr. An manchen Tagen durfte ich das Haus verlassen, an anderen wieder nicht. Ich verstand von all dem nichts, worüber die Erwachsenen diskutierten.
An einem warmen und sonnigen Tag hatte sich Mutter entschlossen, die Fenster unserer Wohnung zu putzen. Ich sollte ihr dabei helfen. Wir waren beide in unsere Putzarbeit vertieft, als uns plötzlich ein ungewohntes Klappergeräusch aus unseren Aktivitäten riß. Wir blickten auf den Bürgersteig hinunter. Meine Mutter schrie auf: „Sieh amol, wer do kommt!“ Ich sah einen zerlumpten Mann, der einen mit Kartons und Mantel beladenen klapprigen Kinderwagen vor sich herschob. Es war Vater, der aus dem Krieg zurückkehrte! Er hatte einen weiten Fußmarsch hinter sich. Wochen- wenn nicht gar monatelang war er unterwegs gewesen, hatte im Freien oder in Scheunen übernachtet: Aus dem Südschwarzwald bis nach Jägerndorf!
Die Sauberkeit der Fenster war jetzt nicht mehr wichtig. Vater war unverletzt, unsere Familie wieder vereint. Jetzt konnte alles nur noch besser werden. Daß jeder Krieg Folgen mit sich bringt, war allen klar. Aber Vater würde wieder seiner Arbeit nachgehen, ich die Schule besuchen, jetzt sollte das Leben beginnen. Vater würde schon für alles sorgen, das war meine kindliche Vorstellung. Wir feierten das Wiedersehen und schmiedeten Zukunftspläne.
Vertreibung aus der Wohnung - Türmitzer Lager
Als Mieter bewohnten wir die obere Etage eines Zweifamilienhauses in der Anzengrubergasse, im sogenannten Happag-Grund. Eines Morgens läutete die Türglocke und gleichzeitig pochte jemand vehement an die Haustür. Unsere Hausbesitzer waren offensichtlich ortsabwesend, denn zu jenem Zeitpunkt bewohnten wir das Haus allein. Meine Mutter ging hinunter, um zu öffnen. Ich hörte befehlende Stimmen. Aufgeregt kehrte Mutter nach oben zurück und sagte mir, daß wir sofort die Wohnung verlassen müßten. Unten stünden Tschechen, die von Haus zu Haus gingen, um die Bewohner dieser Straße zusammenzutrommeln. Es sei nicht nötig, etwas mitzunehmen. Eine warme Decke pro Person genüge, denn wir würden nur wenige Tage wegbleiben.
Nervös suchte meine Mutter das Nötigste zusammen. Die Tschechen drängten zum Aufbruch. In der Straße hatten sich bereits andere Menschen versammelt, alle nur mit einer Decke oder einem Kissen ausgerüstet. Wir, d. h., meine Eltern und mein damals ca. zweijähriger Bruder, schlossen uns der bereits dastehenden Kolonne an.
Nun begann ein - wie mir schien - langer Fußmarsch. Wir mußten alle schön in Reih und Glied bleiben. Irgendwann erreichten wir eine Häusersiedlung, die man „Türmitzer Lager“ nannte. Hier wurden wir eingewiesen. Wenn ich das Wort „Lager“ gebrauche, dann nicht des äußeren Aussehens dieser Siedlung wegen. Im Gegenteil. Wenn ich mich recht entsinne, handelte sich dabei um eine lange ungepflasterte Straße mit sich gegenüberstehenden gleichförmigen ca. 1 - 2stöckigen leerstehenden Häusern, die als Lager vorgesehen waren. Zusammen mit anderen Müttern und Kindern - die Männer wurden anderswo untergebracht - wurden wir in einen Raum gepfercht. Die anderen Zimmer dieser Erdgeschoßwohnung wurden gleichermaßen vollgestopft. Der ca. 14 qm große Raum mußte etwa 15 - 20 Personen fassen. Da er keine Möbel enthielt, breitete jede Familie ihre mitgebrachten Decken auf dem blanken Boden aus. Das war unser Aufenthalts- und Schlafort. Nachdem die Wohnungen dieser Siedlung mit kleinen Bädern und Toiletten ausgestattet waren, hatten wir zumindest Wasser, um uns notdürftig waschen zu können. Wenn man bedenkt, daß jede Wohnung aus etwa 2 - 3 Zimmern bestand, kann man sich bei einer Zimmerbelegung mit ca. 15 - 20 Personen ausrechnen, welch drangvolle Enge herrschte.
Es verging der erste Tag, die erste Nacht. Nichts ereignete sich. Wir mußten in den Zimmern bleiben. Irgendwann schob man einen Kessel mit Suppe durch die Straße. An der Haustür durften wir Essen fassen. Als auch während der nächsten Tage keine Änderung der Situation eintrat, wagten es einige, die Häuser zu verlassen, um mit den uns bewachenden tschechischen Aufsehern zu sprechen. Schließlich hatten wir außer den mitgebrachten Decken keinerlei Wäsche zum Wechseln noch sonst etwas anderes dabei. Wir wurden vertröstet. Noch einige Tage, dann dürften wir wieder in unsere Wohnungen zurück.
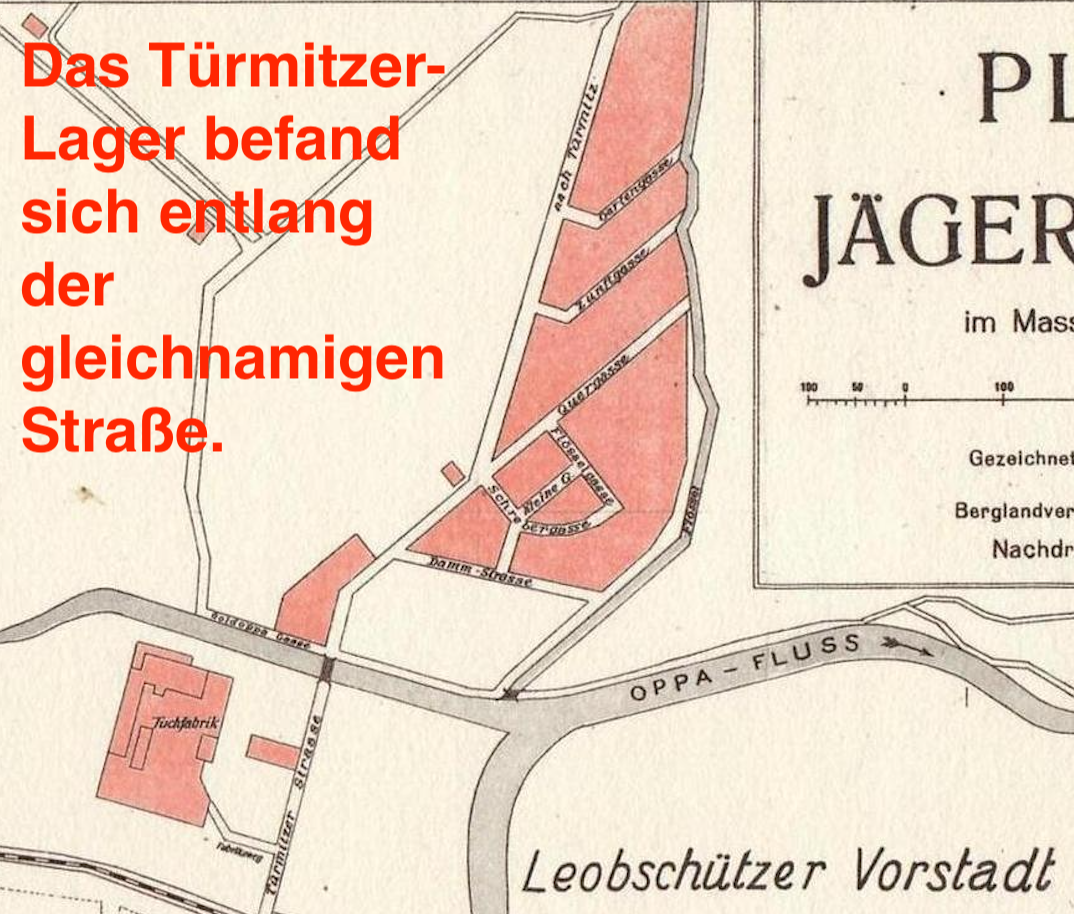
In der Zwischenzeit aber wurde ich Zeuge von Vorfällen, die meine kindliche Seele doch sehr beschäftigten. Mehrmals „kontrollierten“ weibliche und männliche uniformierte Tschechen die Häuser und die Zimmer. Einige der Zimmerinsassen wurden jeweils aufgefordert, sich von ihren Lagern zu erheben. Folgten sie dieser Aufforderung nicht unvermittelt, wurden sie mit Fußtritten oder Gewehrkolben traktiert. Unmittelbar uns gegenüber lagerte eine Frau mit ihren beiden ca. 13 und 15 Jahre alten Töchtern. Die ältere Tochter sollte Auskunft über ihre Aktivitäten beim „Bund deutscher Mädchen“ (BDM) geben, dem sie jedoch offensichtlich nicht angehört hatte. Da das Mädchen nichts darüber berichten konnte, wurde sie geprügelt und getreten. Die kleinere Schwester schrie vor Angst, die Mutter weinte und flehte um Erbarmen für ihre Tochter. Sie vergaß ihre Würde und fiel vor der mit Stiefeln bekleideten Tschechin auf die Knie. Die Anwort auf ihr Flehen war ein weiterer Fußtritt, der nun der Mutter galt. „Wer hatte denn mit uns Erbarmen, als wir im Konzentrationslager waren“, schrie die Tschechin. Zumindest ich hörte damals das Wort „Konzentrationslager“ zum erstenmal und konnte mir nichts darunter vorstellen. Später befragte ich meine Mutter, die ebenfalls nichts darüber wußte, schon gar nicht, daß Tschechen in einem derartigen Lager gewesen sein sollten. Niemand von den anderen Zimmerinsassen hatte während dieser Mißhandlungen den Mut, durch Wort oder Tat einzugreifen. Jeder sah die Unmöglichkeit, hier zu helfen, ein. Wir mußten alle tatenlos zusehen, wie man das Mädchen und die Mutter weiter verprügelte und zwar so lange, bis sie um „Verzeihung baten“ und schließlich erschöpft und blutend auf die Erde sanken. Derartige Szenen wiederholten sich des öfteren und sicher nicht nur in unserem Zimmer. Die ganze Siedlung bestand aus vielen Häusern mit vielen Zimmern!
Das war der Zeitpunkt, an dem ich begann, ständig Fragen nach dem Grund für unseren Zwangsaufenthalt im Lager und nach den Motiven für die unwürdige und brutale Behandlung durch die Tschechen zu stellen. Doch weder meine Mutter noch die anderen Zimmerbewohner konnten mir plausible Erklärungen geben. Auch sie verstanden die Haltung der Tschechen uns Deutschen gegenüber nicht, vor allem dann nicht, wenn es sich um ihnen bekannte Tschechen handelte, mit denen sie früher einträchtig in der gleichen Straße zusammengelebt hatten und denen sie nun hier im Lager in einer anderen Funktion begegneten. Genau diese Tschechen nämlich brachten es fertig, plötzlich kein deutsches Wort mehr verstehen zu wollen, ihre ehemaligen Nachbarn nicht mehr zu kennen. Es war so, als ob sich zwei miteinander verfeindete Nationen zum erstenmal gegenüberstünden. Da sich zur damaligen Zeit die wenigsten Frauen mit den Themen Politik, Wirtschaft oder Geschichte beschäftigt haben, herrschte allgemeine Rat- und Verständnislosigkeit. Wir hatten alle nur Angst. Jeder hoffte, bei einer Befragung unbehelligt und ungeprügelt davonzukommen. Meinen Vater habe ich während des Aufenthaltes in diesem Lager nie zu Gesicht bekommen.
Da während der ersten Lagertage niemand das Haus verlassen durfte, suchten wir Kinder zumindest etwas Abwechslung insofern, als wir das Treppenhaus und die oberen Etagen inspizierten. Auf dem Dachboden angelangt, stellte ich fest, daß auch dieser vollbelegt war. Die Menschen lagen dicht an dicht, zum Teil auf mitgebrachten Decken, zum Teil auf dem blanken Boden. Durch das undichte Dach und die Luken blies der Wind. Die Menschen froren.
Als Kind wird man ja häufig von der Neugierde getrieben. Ich sah zwar dieses Elend, machte aber trotzdem weiter die Runde und entdeckte zu meiner Überraschung und Freude in einer Ecke, unter den Dachbalken liegend, meinen Großvater väterlicherseits. Am anderen Ende des Dachbodens, ebenfalls unter und hinter Balken, meine Cousine mit ihrem wenige Wochen alten Kind, welches später starb, denn Milch gab es keine und Wasser allein genügte dem Kleinen nicht.
Bei meinen täglichen Rundgängen erfuhr ich, daß weitere Verwandte im gleichen Lager, allerdings in einem anderen Haus, untergebracht waren. Meine Beschäftigung bestand nun darin, Besuche bei meinen Verwandten zu unternehmen, die nicht immer auf großen Zuspruch stießen. Als kaum 11jähriges Mädchen war mir noch nicht bewußt, welchen Qualen und Schikanen die Erwachsenen ausgesetzt wurden. Wir Kinder blieben in der Regel von körperlicher Gewalteinwendung verschont.
In der Zwischenzeit hatten es einige Erwachsene doch versucht, Kontakt mit dem Bewachungspersonal aufzunehmen, denn es war durchgesickert, daß unser Zwangsaufenthalt für längere Zeit vorgesehen sein sollte. So mancher glaubte, sich einen Ausgangsschein erbetteln, um aus seiner Wohnung noch einige Dinge holen zu können. Manchen gelang dies auch. Andere wiederum mußten ihre unerlaubten nächtlichen Ausflüge, die dem Zweck dienten, das Lager zu verlassen, schwer büßen. Erwischte man sie, wurden sie entweder verprügelt - oder einfach erschossen.
So verging ein Tag nach dem anderen. Ich besuchte meinen Großvater auf dem Dachboden täglich, doch sein Zustand verschlechterte sich zusehends. Er konnte sich vor Schwäche bald nicht mehr aufsetzen. Ich kroch zu ihm unter die Balken, hockte mich daneben und hielt seine Hand. Ein dankbares Lächeln war seine Antwort auf meinen Versuch, ihm etwas Gutes zu tun. Die uns verabreichten Mahlzeiten, die meist aus irgendwelchen „Wassersuppen“ bestanden, reichten kaum aus, uns zu sättigen. Eines Tages war der Platz unter den Dachbalken leer. Es gab meinen Großvater nicht mehr. Man sagte, er sei verhungert. Erst dann stellte ich mir die Frage, ob ihm überhaupt jemand etwas zum Essen gebracht hat, nachdem er selbst nicht mehr in der Lage war, für sich zu sorgen. Doch in jener Zeit hatte jeder mit sich selbst zu tun. Jeder kämpfte um die einzige ihm zugeteilte Scheibe Brot, um den einen Napf Flüssigkeit, welche den Namen „Suppe“ erhielt, aber im engeren Sinn keine war, denn sie bestand überwiegend aus Wasser, durchsetzt mit einigen Krautblättchen und Kartoffelstückchen.
Im Kreise der Lagerinsassen befanden sich einige junge Frauen, die ihre tschechischen Sprachkenntnisse nutzten, um Verbindungen zum tschechischen Bewachungspersonal herzustellen. Diese Verbindungen sollten dazu dienen, auszukundschaften, warum und wie lange wir eigentlich in diesem Lager bleiben sollten. Mittlerweile strotzten wir vor Dreck. Zwar gab es in jeder Wohnung ein Bad, aber nicht immer reichte auch das Wasser für all die vielen Menschen. An Wäschewaschen war daher nicht zu denken. Wo hätte man sie auch trocknen sollen? Außerdem war das vorhandene Wasser kalt. Es gab seinerzeit nur Badeöfen, die beheizt werden mußten. Heizmaterial war nicht vorhanden. Also war eine Warmwasserzubereitung nicht möglich. In Anbetracht dieser Verhältnisse wollten die Menschen natürlich etwas über ihr Schicksal erfahren. Bald sollten wir einiges mehr wissen, und um an Informationen zu gelangen, wurden alle Möglichkeiten ausgeschöpft.
Es vergingen noch weitere Tage der Ungewißheit. Eines Morgens weckten uns Schüsse und lautes Schreien. Die Erwachsenen eilten an die Fenster, wir Kinder rannten vor die Haustür. Es hatte geregnet. Die nicht befestigte Straße war voller Morast und Pfützen. Ich wurde Zeuge einer Szene, die mir immer im Gedächtnis haften wird. Tschechen mit Gewehren und Knüppeln trieben einige Männer vor sich her. Wenn diese niederstürzten, wurden sie gezwungen, auf dem Bauch im Dreck weiterzurutschen und das Gesicht durch den Straßenschlamm zu ziehen. Blieben sie vor Erschöpfung im Morast liegen, wurden sie wieder aufgeknüppelt und das Spiel wiederholte sich solange, bis sich die Opfer nicht mehr rührten. Einige der Ehefrauen der so Geschundenen hatten sich auf die Straße gewagt in der Hoffnung, helfen zu können. Sie beschworen die Tschechen, mit dieser Tortur aufzuhören. Aber Hohngelächter war die Antwort auf ihr Flehen. Es schien so, als wollten sich die Tschechen bei den Einfällen ihrer Grausamkeiten jeweils überbieten.
Den Grund dieser Treibjagd hat niemand erfahren. Ganz abgesehen davon wurde oft grundlos auf wehrlose Menschen eingeprügelt. Die Tschechen reagierten ihren aufgestauten Haß auf Deutsche wohl auf diese Weise ab. Dabei wurde nicht gefragt oder unterschieden, ob die so Mißhandelten sich irgendwann oder irgendwie den Tschechen gegenüber schuldig gemacht hatten. Hier standen Objekte zur Verfügung, an denen man Frust, Haß, Neid und andere niederträchtige Charaktereigenschaften ausleben konnte, und das tat man mit größter Genugtuung.
Eine Änderung im Lagerleben hatte sich insofern ergeben, als einige Männer und Frauen zur Arbeit außerhalb des Lagers geschickt wurden. Selbstverständlich durften sie das Lager nur unter Aufsicht verlassen, standen tagsüber während der Arbeit unter Kontrolle und wurden abends unter Bewachung wieder ins Lager zurückgebracht. Zu unserem Bekanntenkreis gehörte eine dieser „privilegierten“ Frauen, die das Glück hatte, in einer Färberei schuften zu dürfen. Dort nämlich hatte sie wenigstens Gelegenheit, so nebenbei auch ihre eigene Wäsche mit warmem Wasser durchspülen zu können. Wir Kinder genossen inzwischen mehr Freiheit. Wir durften die Häuser verlassen, um auf der Straße zu spielen. Einige Male wurde mir erlaubt, diese Bekannte zu ihrem Arbeitsort zu begleiten, was mir besonderes Vergnügen bereitete. Zum einen hatte ich noch nie zuvor eine Färberei gesehen, zum anderen gab es dort eine Reihe von Bottichen mit warmem, wenngleich gefärbtem Wasser. Es war für mich wie Geburtstag, wenn ich mich in einen Bottich mit roter oder blauer Brühe setzen und darin plantschen durfte. Ich hatte somit - im Gegensatz zu vielen anderen - die Möglichkeit, ein „Bad“ zu nehmen. Hinterher muß ich wohl wieder mit einigermaßen sauberem Wasser abgespült worden sein, denn meine Mutter hat nie eine Färbung an mir beanstandet.
Mittlerweile hatten unsere eigenen „Lagerspione“ herausbekommen, daß die seinerzeitige Beschwichtigung, wir bräuchten nichts aus der Wohnung mitzunehmen, denn wir kämen bald wieder zurück, nur ein Vorwand war, um uns widerstandslos aus den eigenen vier Wänden herauszuholen. Im Lager herrschte neben Hunger, Schmutz und Ungeziefer eine sehr gedrückte Stimmung. Wir Kinder sahen viele Dinge nach wie vor als Abenteuer an - von den miterlebten Grausamkeiten an den Männern und Frauen abgesehen. Natürlich überkam auch mich Trauer, wenn ich an meine Puppen, an die Spielsachen, vor allem an meine vielen Bücher dachte. Schlimmer war es für meine Eltern. Sie hatten die Wohnung in der Anzengrubergasse erst vor nicht allzulanger Zeit bezogen und sich komplett eingerichtet. Der ausziehbare Spültisch mit den beiden integrierten Kupferwasserkesseln sowie das „deutsche Einheitsschlafzimmer“ war der ganze Stolz meiner Mutter. Für diese Einrichtungsgegenstände hatten meine Eltern lange gespart. Vater, der passionierte Hobbyfotograf, hatte jahrelang auf vieles verzichtet, nur um sich eine Fotoausrüstung und alles, was zum Entwickeln und Vergrößern gehörte, anschaffen zu können. Nun standen sie wieder vor dem Nichts - sie hatten noch weniger als vorher, nämlich nur drei alte Wolldecken.
Hinter vorgehaltener Hand war das Gerücht verbreitet worden, daß es doch die Möglichkeit geben solle, wieder in die Wohnungen zurückzukehren. In den nächsten Tagen würde ein Aufruf erfolgen. Wer sich zuerst melde, sei auch zuerst an der Reihe. Ob dabei nach bestimmten Kriterien ausgewählt werden sollte, blieb unklar. Selbstverständlich herrschte große Euphorie unter den Menschen. Zwar war noch nichts Offizielles bekannt, aber jeder wartete sehnsüchtig auf diesen Appell, um sich sofort melden zu können. Auch Mutter bereitete sich und uns auf dieses Ereignis vor. Offensichtlich drang dieser angekündigte und nur zum Teil durchgeführte Appell nicht an alle Ohren. Wir hatten jedenfalls zu spät davon erfahren und gehörten somit nicht zu den ersten, die das Lager wieder verlassen durften. Einige Tage später jedenfalls war die Straße vor den Häusern voller Menschen. Ihre mitgebrachten Decken trugen sie wieder unter dem Arm. Unter Bewachung verließen sie, schön in Reih und Glied, Junge, Kinder, Greise, das Lager. Weinend schauten ihnen die Zurückgebliebenen nach. Nun, wenn schon nicht beim ersten Schub, so würden wir wohl beim nächsten mitkommen. Damit tröstete uns unsere Mutter.
Eines Abends klopfte es an die Tür. Eine Bekannte rief meine Mutter und einige andere Frauen in den Flur. Es wurde geflüstert und getuschelt. Nach einiger Zeit kehrten sie wieder zurück. Da die soeben erhaltene Geheimnachricht von einer derartigen Wichtigkeit war, hielten es die Informierten für ihre Pflicht und Schuldigkeit, unter dem Siegel der Verschwiegenheit auch die anderen Zimmerinsassen zu informieren. Wir Kinder wurden zum absoluten Schweigen verpflichtet. Wäre eine derartige Kunde nach außen gedrungen, hätte das schwerwiegende Konsequenzen für uns alle, vor allem aber für die Informanten haben können.
Der Aufruf und die Zusammenstellung dieses Fußtransportes hatte nicht dazu gedient, die Menschen wieder in ihre Wohnungen zu lassen. Nein, sie wurden alle deportiert, und zwar in das Gebiet der ehemaligen DDR. Wie sich später herausstellte, waren sie in Nardt, in Guben, in Hoyerswerda gelandet, sofern sie dieses Ziel überhaupt erreichten. Viele haben den wochenlangen Fußmarsch nicht überlebt. Kinder und alte Menschen sind unterwegs vor Hunger und Erschöpfung gestorben und wurden in Straßengräben liegengelassen. Andere, die nicht weiterkonnten, wurden erschossen.
Unser Schicksal schien besiegelt. Man hatte uns aus der Wohnung herausgeholt. Nichts war geblieben außer der Erinnerung an all die schönen Sachen, die wir zurücklassen mußten und die wir nie mehr wieder sehen, geschweige denn haben durften. Welche Hoffnung hatte man uns denn noch gelassen? Es schien nur die beiden Alternativen zu geben: Entweder im Lager unser Leben unter menschenunwürdigen Bedingungen weiterzufristen oder zu Fuß an ein unbestimmtes Ziel getrieben zu werden.
Wie lange wir in diesem Lager zubrachten, ist mir nicht mehr in Erinnerung. In eine gemütliche Wohnung sollten wir jedenfalls so schnell nicht wieder kommen. Das Lagerleben hatte soeben erst begonnen.
Eines Tages wurden auch wir aufgefordert, mit unseren Decken auf der Straße Aufstellung zu nehmen. Unter Schimpfworten der tschechischen Bewacher wurden wir die Straße entlanggetrieben. Wohin es gehen sollte, war uns nicht gesagt worden. Wir sollten woanders untergebracht werden, hieß es nur.
Das gefürchtete Troppauer Lager
Nach einem etwas längeren Fußmarsch erreichten wir ein großes, von Stacheldrahtzaun umgebenes Holzbarackenlager. Das breite Tor war bewacht. Auch innerhalb des Lagers patrouillierten bewaffnete Aufseher die Wege und Plätze. Zusammen mit anderen Frauen und Kindern wurden wir in eine Baracke eingewiesen. Außer der Mutter mit den beiden Töchtern, die schon das Zimmer im Türmitzer Lager mit uns geteilt hatten, kannten wir niemanden. Das Mobiliar bestand aus ca. 10 mit Strohsäcken belegten Stockbetten, einem Tisch und mehreren Stühlen. Die in der Wand eingeschlagenen Nägel dienten als Kleiderhaken. Nun, da wir nur das besaßen, was wir am Leibe trugen, hatten wir auch nicht viel aufzuhängen. An den Stirnseiten des Zimmers befand sich je ein kleines Fenster. Dieser Raum, den wir wiederum mit ca. 20 Personen teilen mußten, sollte nun unser Zuhause für unbestimmte Zeit werden.
Jeder durfte für sich eine Bettstelle in Anspruch nehmen, solange keine weiteren Einweisungen erfolgten. Mutter schlief mit meinem kleinen Bruder zusammen in einem Bett. Ich hatte eine Bettstelle für mich allein. Zu schnell gewachsen und abgemagert, fror ich ständig, so daß sich abends abwechselnd die Barackenbewohner bereit erklärten, jeweils für ein paar Minuten zunächst mein Bett mitzubenutzen, um mich zu wärmen. Nur für eine Zeitlang herrschte bedrängende Enge in der Baracke. Schon nach wenigen Tagen wurden die Erwachsenen aufgefordert, arbeiten zu gehen. Auch meine Mutter gehörte zu den arbeitenden Frauen.
Schon früh am Morgen hatten sich Männer und Frauen, die getrennt in Baracken untergebracht waren, am Tor einzufinden. Unter Bewachung wurden sie zu den unterschiedlichsten Arbeitsstätten gebracht. Am Abend kehrten sie - immer unter Bewachung - wieder ins Lager zurück. Wir Kinder waren uns tagsüber selbst überlassen. Da unsere Baracke überwiegend von Erwachsenen belegt war, hatten wir Kinder tagsüber genug Raum zum Spielen. Außer mir und meinem kleinen Bruder befanden sich nur noch die beiden Mädchen aus dem Türmitzer Lager, ein Junge meines Alters und ein kleineres Kind in der Baracke. Selbstverständlich durften wir uns im Lager frei bewegen. Außer den Wohnbaracken gab es zwei Latrinen, eine Art Verwaltungshütte, eine Baracke für die Essensausgabe und eine, von der man nicht so recht wußte, was sie beinhaltete. Es hieß, wer dort hineingeschickt wird, käme nicht mehr heraus, es handle sich um eine Gaskammer. Um dieses Gebäude machten alle einen großen Bogen.
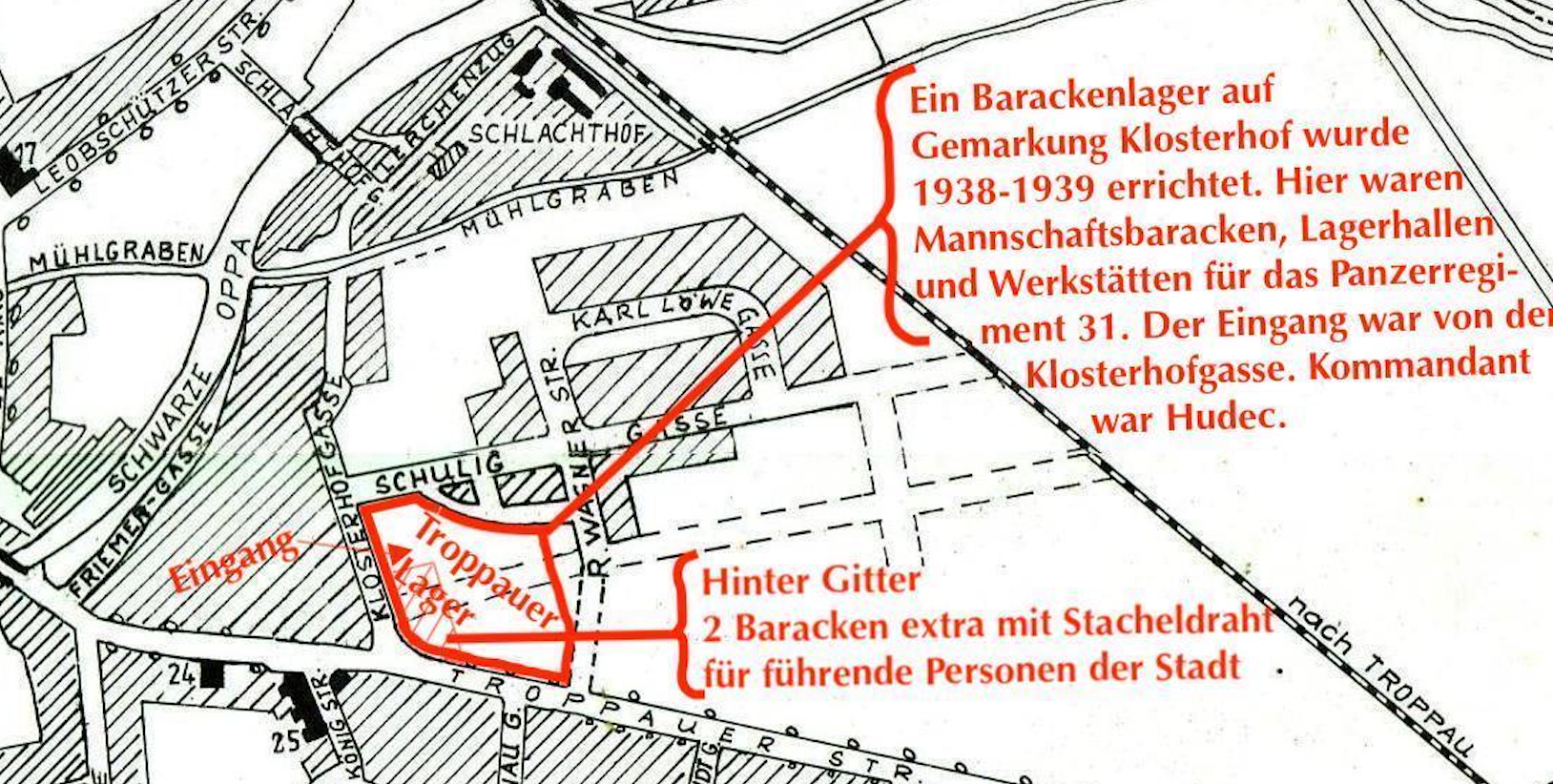
Eines Tages war es soweit. Alle Lagerinsassen wurden aufgefordert, sich vor dieser ominösen Baracke, die zwei Ein- bzw. Ausgänge hatte, aufzustellen. Einige weigerten sich, der Aufforderung, hineinzugehen, Folge zu leisten. Die meisten waren überzeugt, daß dies der Moment der Vergasung sei. Doch jeglicher Widerstand blieb erfolglos. Um keine Prügel zu beziehen, folgte man der Aufforderung. Ob dort tatsächlich Menschen vergast wurden, weiß ich nicht. Wir folgten jedenfalls den uns Vorangehenden. Kaum hatten wir die Baracke betreten, mußten wir die Kleidung ablegen. Unsere Körper und Kleidungsstücke wurden mit irgendeinem beißend riechenden weißen Zeug bestäubt. Es handelte sich wohl um ein Mittel gegen Flöhe und Wanzen, die uns mittlerweile übel zusetzten. Nachdem wir diese „Puderschleuse“ durchlaufen hatten, durften wir uns wieder anziehen und die Hütte verlassen. Wir waren alle erleichtert, als wir uns wieder auf dem freien Platz befanden. Dennoch glaubten einige, Anzeichen von Gas- oder Folterkammern entdeckt zu haben. Bestimmte Türen und Vorrichtungen deuteten darauf hin, so wurde gesagt. Andere wiederum wollten entdeckt haben, daß vor Tagen Menschen hineingeschleust, aber später nicht mehr gesehen worden seien. Auf jeden Fall war diese Baracke das mysteriöseste, aber auch gefürchtetste Gebäude des ganzen Lagers.
Grausamkeiten waren auch hier, vermehrt noch als im Türmitzer Lager, an der Tagesordnung. Überwiegend spätabends oder nachts kamen die Bewacher in die Baracken, zerrten die Leute aus den Betten, verhörten oder verprügelten sie. Voller Unverständnis verfolgten wir Kinder diese nächtlichen Szenen. Immer wieder stellte ich die Frage:
„Mutti, warum schreien die Tschechen Frau M. so an, warum schlagen sie sie immer wieder, wenn sie doch gesagt hat, daß sie nichts weiß? Wenn sie wirklich nichts weiß, kann sie doch auch keine Auskunft geben!“
„Mädle, dos konn ich dir ah nie sogn, ich verstehs ah nie“, war meist ihre Antwort.
Mein kindlich logischer Verstand jedenfalls sagte mir, daß ich nur dann eine Frage beantworten kann, wenn ich die Antwort weiß. Weiß ich etwas nicht, dann kommt mir auch durch Prügel keine Erleuchtung. Daher auch immer meine Zusatzfragen:
„Glauben die Männer der Frau denn nicht, oder kapieren sie nicht, daß man nicht wissen kann, was man nicht weiß?“
Manchmal brachte ich nicht nur meine Mutter, sondern auch die anderen Barackeninsassen durch meine viele Fragerei in Bedrängnis. Für solch unlogische Handlungsweisen seitens der Tschechen konnten auch sie kein Verständnis aufbringen. Ich wurde mit der Erklärung „die wollen eben ihre Macht zeigen und prügeln“ abgefunden. Doch dafür konnte ich erst recht kein Verständnis aufbringen. Zwar war ich streng erzogen worden und hatte so manche Ohrfeige, so manche Schläge über mich ergehen lassen müssen, doch war dieser Züchtigung jeweils mein Ungehorsam vorausgegangen. Also stand für mich fest: Strafe nur für den, der Unrecht getan hat. Warum aber schlägt man Menschen, die auf Fragen wahrheitsgemäß antworten, d. h., wenn sie behaupten, etwas nicht zu wissen, und die kein Unrecht begangen haben? Derartige Überlegungen beschäftigten sehr intensiv meinen kindlichen Verstand.

Jedoch nicht nur diese nächtlichen Besuche mußten wir über uns ergehen lassen. Nein, sehr häufig ertönte um Mitternacht eine Sirene, das Lager wurde durch Scheinwerfer hell erleuchtet und wir alle, Männer, Frauen, Kinder, hatten uns auf dem Hauptplatz einzufinden und das Deutschlandlied zu singen. Ich fragte wieder Mutter:
„Mutti, warum tun das die Tschechen mit uns? Sind Deutsche schlechter als andere Menschen?“
Mutter wußte auf meine Frage keine Antwort.
„Dos konn ich dir ah nie sogen, mir hom denen nie wos geton“, sagte sie in ihrer Jägerndorfer Mundart mehr zu sich selbst als zu mir.
Die unhygienischen Zustände im Lager - man holte das Wasser von irgendwoher und wusch sich notdürftig in einem Eimer - führten sehr bald zu unliebsamen Folgen. Ich, und viele andere, bekamen die Krätze. Zwischen den Fingern und auf meinem Handrücken war bald keine Haut sondern nur noch rohes Fleisch zu sehen. So sehr mich meine Mutter auch ermahnte, nicht zu kratzen, ich hielt den Juckreiz nicht aus. Und je mehr ich kratzte, um so mehr entzündete sich die Haut. Irgendwann schüttete mir jemand Brennspiritus über die Hände. Obwohl es wahnsinnig brannte, war dieser Schmerz sogar noch leichter zu ertragen als das ewige Jucken. Einer Mitbewohnerin war es irgendwann gelungen, eine Salbe aufzutreiben, die ich mehrmals täglich auftrug. Damit versuchten wir dann, diesem Übel Herr zu werden.
Noch schlimmer als die Krätze setzten uns Flöhe, Läuse und Wanzen zu. Mein ganzer Körper war voller roter Punkte. Die Wanzen hatten sich in allen Ritzen der Betten und in den Strohsäcken eingenistet. Ich kratzte mir fast die Haut von Leib und Kopf. Die Läuse in meinen Haaren hatten sich unter den dicken Grinden, die sich nach dem Aufkratzen und dem nachfolgenden Bluten gebildet hatten, festgesetzt. Ich trug Zöpfe und Mutter versuchte alles, um meinen Kopf sauberzuhalten. Dazu gehörte auch das tägliche Kämmen mit dem sogenannten Lausekamm. Natürlich blieben etliche Läuse im Kamm hängen, gleichzeitig aber riß mir Mutter beim Kämmen immer wieder die Grinde auf, noch mehr Läuse kamen zum Vorschein, und die Kopfhaut verkrustete nach jedem Bluten um so mehr. Ich hatte schreckliche Angst vor dieser täglichen Prozedur. Doch meine Mutter bestand darauf, weil sie sonst keine andere Möglichkeit sah, die Läuse zu dezimieren. Etliche Male wurde mir auch Brennspiritus über Kopf und Körper gegossen. Es waren höllische Schmerzen.
In gewissen Abständen räumten die Lagerinsassen alle Stockbetten nach draußen. Sie wurden, so gut es ging, auseinandergenommen. Mit einer brennenden Kerze versuchte man, die in den Ritzen versteckten Wanzen und Flöhe auszuräuchern. Doch ein Großteil des Ungeziefers steckte in den Strohsäcken, und die konnte man nicht anbrennen. Zwar wurden die Strohsäcke geöffnet und versucht, die davonhüpfenden Flöhe zu fangen, aber all diese Mühen brachten kein großes Ergebnis. Nach einer solchen Aktion hatten wir zwar jeweils den Eindruck, vom Ungeziefer nicht mehr ganz so gequält zu werden, aber nach kurzer Zeit war wieder alles verlaust und verwanzt und die Tortur begann von neuem. Glücklicherweise hatten Lagerinsassen unterschiedliche Gegenstände aus ihren Wohnungen retten bzw. anderweitig organisieren können. Nur so kann das Vorhandensein von Kerzen, Streichhölzern oder anderen Kleinigkeiten erklärt werden. Daß man sich in dieser Situation gegenseitig aushalf, versteht sich von selbst.
Neben dem Ungeziefer quälte uns der Hunger. Außer etwas dünnem Kaffee am Morgen und einer Scheibe Brot pro Tag und Person gab es nichts. Wegen der Scheibe Brot mußte man sich schon frühmorgens anstellen. Wer großes Glück hatte, kam nicht nur in den Genuß dieser Scheibe, sondern sogar einer großen Scheibe. Hatte man das Pech, gerade dann an der Reihe zu sein, wenn der Rest des Brotes ausgeteilt wurde, dann bekam man nur den letzten Kanten, das Knabele, wie es Mutter nannte. Häufig jedoch reichte das Brot nicht für alle Lagerinsassen. Da Mutter schon morgens das Lager verließ, um ihrer Arbeit nachzugehen, war es meine Aufgabe, für uns drei die Brotscheiben abzuholen. Obwohl ich immer ganz früh zur „Brotbaracke“ hinlief und mich in die Warteschlange einreihte, passierte es häufig, daß das Brot entweder schon ausgeteilt war oder es eben an diesem Tag keines gab. Für meine Mutter muß es immer eine große Enttäuschung gewesen sein, wenn sie abends von der Arbeit zurückkam und keine Scheibe Brot vorfand.
Wie oft kehrte ich nach einer langen Wartezeit vor der „Brotbaracke“ mit leeren Händen zurück. Der Magen knurrte, ich weinte, denn auch für meinen kleinen Bruder gab es keine Sonderration. Eine Scheibe Brot pro Person und Tag, das war alles. Und oft mußte man eben mit einer Scheibe auch zwei Tage auskommen. Es war daher nur natürlich, daß Menschen vor Schwäche umfielen, Kinder und Alte an Unterernährung starben. Am bedauernswertesten waren diejenigen - und dazu gehörten meine Eltern - die außerhalb des Lagers den ganzen Tag (zwangs)arbeiten mußten. Ihre Körper waren so geschwächt, daß sie keinerlei Widerstandskraft mehr besaßen. Viele konnten sich morgens nur noch zur Arbeit schleppen und niemand wußte, ob sie den Tag überleben würden. Die Tschechen nahmen darauf keine Rücksicht. Je mehr starben, um so weniger gab es von diesen verhaßten Deutschen.
Was und wo meine Mutter arbeitete, habe ich nie erfahren. Hin und wieder brachte sie in einem kleinen zerbeulten Töpfchen Essensreste mit, die zwischen meinem Bruder und mir aufgeteilt wurden. Ich habe nie danach gefragt, wo sie diese Reste zusammengekratzt hat. An Hygiene wurde damals nicht gedacht. Man hatte Hunger und hätte alles in sich hineingestopft, wenn es nur nach Lebensmittel roch und aussah. Gierig machte ich mich jedesmal über diese Reste her. Mutter verfolgte jeden meiner Bissen mit glänzenden Augen. Später, viel viel später, wurde mir bewußt, daß der Glanz in den Augen meiner Mutter nicht Freude über meinen Appetit, sondern Tränen waren. Sie selbst hatte wohl den ganzen Tag auf Essen verzichtet, um es uns geben zu können. Hungrig und mit leerem Magen mußte sie nun zusehen, wie wir möglicherweise den Lohn ihrer Arbeit - vielleicht waren diese Brocken das Entgelt für ihre Schufterei - aufaßen. Wir Kinder machten uns damals keine Gedanken. Wir bekamen etwas mitgebracht und es schmeckte uns. Es mag für eine Mutter zum einen eine Genugtuung sein, ihren hungrigen Kindern etwas geben zu können. Andererseits aber hatte sie Zwangsarbeit leisten müssen, ohne Bezahlung, ohne Essen. - Die Scheibe trockenes Brot, auf die sie sich gefreut hatte, konnte ich ihr oft nicht geben.
Unseren Vater haben wir während des Aufenthaltes im Troppauer Lager nicht gesehen. Wie bereits erwähnt, waren die Männer in einem anderen Barackentrakt untergebracht und weitaus größeren Torturen ausgesetzt als die Frauen. Auch er arbeitete außerhalb. Wie sich allerdings erst später herausstellen sollte, erfuhr unser Familienleben gerade seines Arbeitsplatzes wegen eine etwas glücklichere Wende.
Etwas Widerwärtiges waren für mich die Latrinen. Zum einen schämte ich mich, mit nacktem Unterteil hier zusammen mit anderen Frauen und Kindern sitzen zu müssen, zum anderen hatte ich eine wahnsinnige Angst, in die Grube zu fallen. Bei der Latrine handelte es sich um eine Bretterbude ohne Türen. Es gab zwar ein Dach, aber der Wind pfiff durch die Bretter und Öffnungen. An jeder Längsseite der Grube befand sich ein Sitzbalken. Bei vollbesetzter Latrine konnten etwa 40 - 50 Menschen gleichzeitig ihre Notdurft verrichten. Da es keine andere Möglichkeit gab, als sich am Sitzbalken selbst festzuhalten, wagte ich meist nicht, mich hinaufzusetzen, zumal meine Füße nicht ganz auf den Boden reichten. Nicht nur die Vorstellung, in diese Grube zu fallen, ließ mich erschauern, sondern auch die Erzählungen der um mich Herumsitzenden schürten meine Angst. Hier erhielt das Wort „Latrinengerücht“ seine richtige Bedeutung. So erzählte man sich zum Beispiel, daß es Fälle gegeben habe, in denen Menschen zur Strafe in Latrinen geworfen und andere gezwungen wurden, trotzdem oder gerade deshalb, ihre Exkremente darauf fallen zu lassen. Andere berichteten von Fällen, in denen man Verstorbene oder erschossene Menschen einfach in Latrinen entsorgt hat. Irgendwann waren sie unter dem Kot verschwunden. Wann immer ich eine der beiden Latrinen betrat, suchte ich - so ekelhaft es auch war - mit den Augen die Grube ab. Der Gedanke, daß da unten jemand liegen könne, hat mich nie losgelassen.
Doch auch andere Geschichten erfuhr man an diesem sehr stinkigen Ort. Hier war man unter sich, nicht unter Aufsicht, hier konnte man seinen Gedanken und Worten freien Lauf lassen. Das hörte sich dann so an: „Wißt Ihr, was man mit Frau XY gemacht hat? Ihr Kopf wurde kahlgeschoren. Man hat sie an den Pfahl neben einer Baracke festgebunden und läßt schon seit vielen Stunden ständig Wassertropfen auf immer die gleiche Stelle ihres Kopfes fallen. Sie kann sich nicht wehren und ist dem Wahnsinn nahe. Das gleiche Schicksal ist vor ihr schon anderen widerfahren.“ Oder: „Gestern abend hat man wieder einige Männer schreien hören. Sie waren gezwungen worden, im Dreck Liegestützen zu machen, 20, 30 hintereinander. Wenn sie es vor Schwäche nicht schafften, drosch man ihnen Knüppel ins Kreuz oder schlug sie ins Genick. Und wenn sie nicht mehr in der Lage waren, sich wieder aufzurichten, wurden die anderen Deutschen aufgefordert, mit Prügeln auf sie einzuschlagen, weil sich die Tschechen an der verdreckten Kleidung dieser Armseligen die Hände nicht beschmutzen wollten. Ich weiß das von dem Jugendlichen K., der zur Baracke der Männer geschlichen ist, um den Aufenthaltsort seines Vaters ausfindig zu machen.“

Solche und ähnliche Greuelgeschichten bekam ich fast täglich zu hören. Häufig handelte es sich um Vorfälle, die mein Fassungsvermögen überstiegen. Ich konnte nicht glauben, daß es Menschen gibt, die solch grausamer Taten fähig sind. Und warum tut man das alles, fragte ich mich oft. Warum mußten wir aus der Wohnung, warum werden hier so viele verprügelt, warum gibt man uns nichts zu essen, warum, warum? Ich war ein Kind von knapp 11 Jahren. Ich wußte nur, daß wir Deutsche und die anderen Tschechen sind. Aber warum wir von den Tschechen so behandelt und mißhandelt werden, habe ich nie verstanden.
Es vergingen Wochen und Monate, mal gab es mehr, mal weniger Wanzen und Flöhe. Tagen der Schikane folgten auch Tage der Ruhe. Nach jedem Regen glich das ganze Lager einer einzigen Schlammwüste. Menschen erkrankten, Menschen brachen plötzlich zusammen, starben. Ich erinnere mich nicht mehr, wie oft wir des Nachts antreten und das Deutschlandlied singen mußten. Ich habe auch nicht die Schüsse gezählt, die nachts durch das Lager peitschten. Irgendwann erfuhr man dann bei einer Latrinensitzung, daß es wieder mal einen erwischt hatte, der das Lager unbemerkt verlassen wollte. Als Kind interessiert man sich glücklicherweise nicht für alle Einzelheiten, man hört vieles nur so nebenbei. Aber all das, was ich in diesem Lager bewußt mitbekommen und erlebt habe, hat sich tief in meiner Seele eingeprägt. Einige Bilder stehen noch heute unauslöschlich vor meinem geistigen Auge.
Wie lange unser Aufenthalt in diesem Troppauer Lager dauerte, weiß ich nicht. Ebensowenig vermag ich mich zu erinnern, zu welcher Jahreszeit wir dort untergebracht waren. Doch bald sollte der Tag kommen, an dem wir wieder ein echtes Familienleben außerhalb des Stacheldrahtzaunes führen durften. Diese Veränderung verdanken wir dem damaligen Arbeitgeber meines Vaters, Herrn Slovaček. Dank seiner Hilfe konnte die Familienzusammenführung erfolgen. Er war zwar Tscheche, ist den Deutschen gegenüber aber Mensch geblieben.
Im Hause des tschechischen Geschäftsmannes Slovaček
Die Familie Slovaček stammt - so hatten wir erfahren - aus Prag oder Brünn und war, wie viele andere Tschechen auch, nach dem Kriege in die ehemals deutschen Gebiete übergesiedelt.
Herr Slovaček war Besitzer des Elektro- und Radiogeschäfts am Masarykplatz, früher Rathausplatz. Auf welche Weise mein Vater, gelernter Elektro-, Rundfunk und Fernmeldetechniker, zu diesem Arbeitsplatz kam, ist mir nicht bekannt. Fest stand, Vater war erste Kraft bei Slovaček und wurde von diesem sehr geschätzt. Zur damaligen Zeit standen Reparaturarbeiten hoch im Kurs. Die Anschaffung neuer Geräte konnte sich kaum jemand leisten. Es gab nichts, was Vater nicht zu reparieren in der Lage gewesen wäre. Die Kunden strömten, das Geschäft lief gut. Slovaček, der mit meinem Vater sehr zufrieden war, fühlte sich ihm verpflichtet. Dieser Verpflichtung entledigte er sich in der Weise, daß er auf Bitten meines Vaters bei der Lagerverwaltung vorstellig wurde, und unter Hinweis auf die Notwendigkeit einer Fachkraft, nämlich der meines Vaters, den Antrag auf Freilassung aus dem Lager und Familienzusammenführung stellte. Als weiteren Grund hatte er angeführt, dringend eine Putzfrau für sein Geschäft zu benötigen. Diese Arbeiten sollte meine Mutter übernehmen. Es war zwar nicht gerade eine Ehre für Mutter, als Putzfrau tätig zu werden, doch unter den damaligen Umständen waren die Eltern froh, dem Lager entrinnen und einige Kronen verdienen zu können. Slovaček, der in einem anderen Stadtteil wohnte, bangte auch um die Sicherheit seines Ladens, da das komplette Gebäude, in dem sich im Erdgeschoß das Elektrogeschäft befand, unbewohnt war. Die Mieter waren vertrieben worden, die eingerichteten Wohnungen standen leer. Des Nachts streunten Zigeuner durch sämtliche leerstehenden Häuser und ließen alles mitgehen, was nicht niet- und nagelfest war.
Dank dieser Fürsprache konnten wir also das Lager verlassen. Slovaček hatte nun sein Personal und, wie er glaubte, eine Bewachung für Geschäft und Gebäude. Im Geschäftshaus standen uns alle Wohnungen, natürlich komplett eingerichtet, zur Auswahl zur Verfügung. Wir entschieden uns für die in der zweiten Etage, die zudem noch durch eine Tür mit der danebenliegenden Wohnung verbunden war, so daß wir ein ganzes Stockwerk für uns hatten. Zum einen war es herrlich, sich nach einer so langen Zeit des Lagerlebens wieder ausbreiten zu können, andererseits aber waren wir uns klar darüber, daß wir uns der Einrichtungsgegenstände von Menschen bedienten, die, ebenso wie wir, vertrieben worden waren.
Vater arbeitete den ganzen Tag unten im Laden. Unsere Mutter verrichtete in den Vormittagsstunden ihre Putzarbeiten. Auf diese Weise hatten meine Eltern ein kleines Einkommen, auch wenn man sich zur damaligen Zeit kaum etwas kaufen konnte. Es gab so gut wie nichts, schon gar nichts für uns Deutsche. Wenn ich mich recht erinnere, benötigte man sogar noch Lebensmittelkarten.
Wir fühlten uns - zumindest tagsüber - in diesem Haus sehr wohl. Des Nachts allerdings wurden wir häufig gestört und nicht wenige Male brach herumstreunendes Gesindel die Haustür auf, um in den freistehenden Wohnungen zu plündern. Man schlief daher fast immer mit „einem wachsamen Ohr“, um sich als Anwesende im Hause sofort bemerkbar machen zu können. In der Regel genügte es, polternd die Wohnungstür zu öffnen, das Treppenhaus zu beleuchten und die Stimme zu erheben. Da die Eindringlinge das Haus unbewohnt vermuteten, reichte dieser Überraschungseffekt zur ersten Abschreckung aus. Allerdings kam es manchmal auch zu unliebsamen Wortwechseln, glücklicherweise aber nicht zu Handgreiflichkeiten.
Das Leben in den Lagern hatte seine Spuren an uns hinterlassen. Wir waren schwach und unterernährt. Wie bereits gesagt, waren Lebensmittel für uns Deutsche kaum zu haben. In den meisten Geschäften wurden wir abgewiesen. Mutter mußte des öfteren, mit einem in tschechischer Sprache geschriebenen Einkaufszettel versehen, auch für Slovačeks einkaufen. Diese Gelegenheit nutzte sie dann, um auch für uns einige Kleinigkeiten zu erstehen, sofern unser Geld dazu überhaupt reichte. Zwar lebten wir jetzt in einer schön eingerichteten großen Wohnung, waren aber dennoch fast mittellos. Das geringe Einkommen meiner Eltern reichte nur für das Nötigste, vorausgesetzt, die tschechischen Geschäftsleute verkauften uns überhaupt etwas. Mein kleiner Bruder, mittlerweile drei Jahre alt, konnte sich vor Schwäche kaum auf den Beinen halten, er mußte fast ständig getragen werden. Wenn unsere Mutter wieder einmal ohne Waren von ihrem privaten Einkaufsgang zurückkam, weil man sie aus den Geschäften gewiesen hatte, machte ich mich zusammen mit meinem Bruder, den ich mir auf die Schultern lud, auf den Weg. Hin und wieder gelang es mir, in einem Gemüse- oder Bäckerladen etwas zum Essen zu erstehen, aber sehr oft wurde auch ich aus den Geschäften gejagt. Ich trug Zöpfe, ein sichtbares Zeichen für Deutschtum. Mutter wollte meine langen Haare trotzdem nicht abschneiden lassen. Darüber hinaus mußten sich deutsche Bürger durch ein „N“ als solche zu erkennen geben. Hatten während der Nazizeit die Juden ihren Stern zu tragen, so war es jetzt für uns das „N“, also Némec.
Meinen Bruder, der als kleines Kind über eine schöne Singstimme verfügte, hatte ich daraufhin abgerichtet, in Geschäften zu singen, und dann z. B. nach „chléb bez lístku“ (Brot ohne Marken) zu bitten. Ein paar Brocken Tschechisch hatte ich von anderen Kindern aufgeschnappt. Ob sie grammatikalisch richtig waren, kümmerte mich nicht. Er sang jedenfalls herzerweichend, auch wenn ihm die Bedeutung der Worte nicht klar war. Seine Lieblingslieder hießen „Hoch droben auf dem Berg“ und „Blaue Jungs“. Statt des Textes „Nur die Liebe, nur die Liebe ganz allein…“ sang er munter „Nurdele, nurdele, Gans allein…“. Manchmal klappte das mit dem Brot. Es passierte aber auch, daß man ihn vertrieb oder fragte, warum denn die große Schwester nicht wieder selbst hereinkäme, nachdem sie heute morgen schon einmal da war.
Es gab jedoch auch Tage, da konnten weder Mutter noch wir etwas in den Geschäften auftreiben. So versuchte ich es hin und wieder auch mit Betteln. Ich bettelte nicht um Geld, sondern um Lebensmittel, wenn ich sah, daß Tschechinnen mit vollbepackten Taschen aus den Läden kamen. Die Erfolge waren niederschmetternd, denn von wenigen Ausnahmen abgesehen, wurde ich mit Ohrfeigen traktiert, als dreckige Deutsche, oder gar als deutsches Schwein beschimpft.
Um überhaupt täglich etwas auf den Tisch bringen zu können, mußte sich unsere Mutter alles Mögliche ausdenken. Es war bekannt, daß man aus Brennesseln Spinat zubereiten könne. Wir achteten nicht darauf, ob die Blätter noch vor oder schon nach der Blütezeit gepflückt wurden. Es kam nur darauf an, Gemüse daraus zu kochen. Manchmal wurde auch anderes Grünzeug gesammelt und in der Küche verarbeitet. Wenn wir ab und zu Brot geschenkt bekamen, dann war das durchaus nicht immer frisch. Aber aus altem hartem Brot konnte man in der Backröhre „Scheiterhaufen“, ein sudetendeutsches Gericht, zubereiten. Milch holte ich täglich. Ab und zu fiel auch mal ein Apfel irgendwo ab. Auf die zu diesem Gericht gehörenden Eier mußten wir eben verzichten. Wir hatten Hunger, deshalb schmeckte uns alles, was wir auf den Teller bekamen. Manchmal gab es an den Wochenenden auch Torte. Nach welchem Rezept die gebacken wurde, ist mir bis heute nicht klar. Fest steht, daß unsere Mutter auch mit dem Kaffeesatz, bei dem es sich nicht um Bohnen- sondern um den sogenannten „Spitzkaffee“, also geröstete Gerste, handelte, sorgsam umging. Mit einigen weiteren billigen Zutaten zauberte sie jedenfalls eine Kaffee- oder wie wir es nannten, eine Schokoladentorte. Nicht nur wir selbst, auch unsere Mägen hatten sich einzuschränken. Auch wenn wir alle an Unterernährung litten - von der erforderlichen Zufuhr an lebenswichtigen Vitaminen ganz abgesehen - hatten wir wenigstens so viel zu essen, um am Leben zu bleiben.
Da ich keine Schule besuchte, stand mir der ganze lange Tag zur freien Verfügung. Spielgefährten hatte ich so gut wie keine. Von den tschechischen Kindern wurde ich abgelehnt, wenn nicht gar vertrieben. Diese Kinder waren sich ihrer Handlungsweise sicher nicht bewußt. Aufgehetzt von den Eltern, falsch unterrichtet, taten sie eben das, was man ihnen eingetrichtert hatte: Deutsche ächten, beschimpfen, bespucken, verhöhnen, wenn möglich, auch schlagen. Es war für uns deutsche Kinder daher nicht leicht, uns unbehelligt im Kreise anderer zu bewegen, geschweige denn, Anschluß zu finden. Doch welches Kind denkt ständig an Rassenhaß, wenn es andere spielende Jugendliche sieht und sich ihnen anschließen möchte? So war auch ich ständig auf der Suche nach Abwechslung und Kommunikation.
In der Nähe des Jägerndorfer Eislaufplatzes befand sich eine Art Vergnügungspark mit Schaukeln, Karussell, Schießbuden und anderen Belustigungen. Kinder werden natürlich von solchen Attraktionen angezogen. Wie gerne wäre auch ich einmal mit dem Karussell gefahren. Doch für solche Vergnügungen hätten mir meine Eltern kein Geld gegeben und auch nicht geben können. Dieser Rummelplatz war übrigens der einzige Ort, an dem ich manchmal Kontakt mit tschechischen Kindern bekam, die mich nicht gleich verprügelten.
Eines Tages hatte ich einen genialen Einfall. Ich setzte meinen kleinen Bruder auf ein Mäuerchen und befahl ihm, sich nicht wegzurühren. Dann begab ich mich zum Kettenkarussell, stieg die drei Holztreppen hoch, ging von Sesselchen zu Sesselchen und kassierte das Geld. Der Betreiber warf mir zunächst einen bösen, dann einen argwöhnischen Blick zu, aber er ließ mich gewähren. Nachdem ich alle Kunden abkassiert und sich das Karussell in Bewegung gesetzt hatte, ging ich zum Kassenhäuschen und übergab dem Besitzer das Geld. Er steckte es kommentarlos ein. Ich wartete die nächste Runde ab und kassierte wieder. Mein kleiner Bruder, ohnehin geschwächt, blieb still auf seinem Mäuerchen sitzen und sah meinem Treiben zu. Dieser Aktivität, die mir außerdem Spaß machte, ging ich den ganzen Nachmittag nach. Ich verfolgte damit keinen bestimmten Zweck. Ich wollte nur irgend etwas Nützliches tun, wollte beweisen, daß ich als deutsches Kind helfen und arbeiten kann. Offensichtlich wurde ich vom Vater eines Karussell fahrenden Kindes beobachtet. Nach einiger Zeit des Zusehens rief er mich zu sich, drückte mir die Anzahl von Heller, die für zwei Personen erforderlich waren, in die Hand, und forderte mich auf, mit meinem Bruder das Karussell zu besteigen. Ich muß ihn wohl ganz entgeistert angesehen haben, denn er lächelte. Wann hatte mich jemals ein Tscheche angelächelt? Bis zu diesem Tag wurde ich doch höchstens verjagt oder verprügelt. Ich nahm das Geld, bedankte mich freudig, holte meinen Bruder, setzte ihn auf meinen Schoß, und dann durften auch wir einmal durch die Luft fliegen. Der Karussellbesitzer machte zunächst Anstalten, unser Mitfahren zu verhindern, aber eine Geste des edlen Spenders hatte ihn wohl umdenken lassen. Mit mürrischem Blick verfolgte er unsere Freude. Überglücklich kehrte ich an diesem Tag nach Hause zurück.
„Mutti, ein Tscheche hat uns Geld geschenkt, damit wir Karussell fahren können“, rief ich meiner Mutter schon an der Tür entgegen.
„Wos“, fragte sie ungläubig, „a Tscheche hot eich Geld gegäben fürs Karussellfohrn? Ja gibt's denn sowos heit ah noch?“ Meine Eltern konnten es kaum glauben, daß uns ein Tscheche Geld geschenkt haben soll.
Dies war einer der wenigen Freudentage. Kurze Zeit später sollte ich gleich wieder erfahren, was es heißt, eine Deutsche unter Tschechen zu sein. Da meine Mutter am Vormittag im Geschäft und in der Werkstatt zu tun hatte, wurde ich täglich zum Milchholen geschickt. Der Milchladen befand sich auf der gegenüberliegenden Seite des Platzes. Daß ich, mit meiner Milchkanne in der Hand, häufig mehr als eine Stunde warten mußte, bis ich endlich bedient wurde, war keine Seltenheit. Man kannte mich und wußte, daß es sich bei mir um ein deutsches Kind handelte. Also wurde ich immer wieder nach hinten gedrängt und hatte zu warten, bis die tschechischen Kunden abgefertigt waren. Schließlich mußte die Besitzerin des Geschäftes ihren tschechischen Kunden gegenüber demonstrieren, daß sie wisse, wie man Deutsche behandelt. Fast täglich traf ich mit einem tschechischen Jungen zusammen, der immer wieder versuchte, mich zu zwicken, zu puffen oder mir Fußtritte zu versetzen. Er hatte in etwa mein Alter und richtete es im Gedränge des Ladens immer so ein, daß er einen Platz in meiner Nähe fand, um mich drangsalieren zu können. Ich bemühte mich stets, seinen Fußtritten, die von den umstehenden Erwachsenen nicht bemerkt wurden, auszuweichen, doch nicht immer gelang mir das. Eines Tages passierte das, was ich schon des öfteren befürchtet hatte. Ich befand mich unmittelbar vor der gläsernen Theke. Der Junge stand hinter mir und schlug mir wieder in ununterbrochener Folge seine Schuhspitzen in Kniekehle und Waden. Aber es gelang mir, im rechten Augenblick zur Seite zu treten. Sein nächster Fußtritt traf nicht mich, sondern sein Fuß knallte mit ganzer Wucht in die Glastheke, die natürlich zu Bruch ging. Es erhob sich ein großes Geschrei und mehrere Kunden einschließlich der Besitzerin des Milchgeschäftes stürzten sich auf mich. Ich versuchte, mich zu rechtfertigen, indem ich den Vorgang schilderte. Doch wer glaubte schon einer Deutschen. Der tschechische Junge brachte seine Version vor und zeigte mit einer Unschuldsmiene auf mich. Er sei still hinter mir gestanden und habe nichts getan. Die Besitzerin verlangte, meinen Namen und meine Anschrift zu wissen, denn meine Eltern hätten den Schaden zu ersetzen. Der aufgebrachten Menschenmeute entkam ich nur, indem ich schleunigst mit meiner leeren Milchkanne den Laden verließ und nach Hause rannte.
Weinend und zitternd kam ich zu Hause an.
„Wos is n heite schon wieder passiert“, fragte mich besorgt meine Mutter.
Von den ständigen Fußtritten des tschechischen Jungen hatte ich zwar schon öfter berichtet, aber Mutter sah auch keine Möglichkeit, wie sie oder ich mich vor solchen Bösartigkeiten bewahren könnte. Sie riet mir nur, zu versuchen, die Nähe dieses Jungen zu meiden, sobald wir uns zur gleichen Zeit im Laden befanden. Diese meine Versuche waren bisher immer fehlgeschlagen, denn besagter Knabe fand zwischen den wartenden Kunden immer wieder ein Schlupfloch, um sich an mich heranzupirschen. Unter Schluchzen erzählte ich, was sich im Laden abgespielt hatte. Meine Mutter war nun sehr beunruhigt, denn zum einen hätten meine Eltern niemals das Geld aufgebracht, um die Glastheke zu ersetzen, zum anderen hätte ich dieses Geschäft nicht mehr betreten dürfen. Da sich Ereignisse, die mit Deutschen zusammenhingen, schnell herumsprachen, mußten wir befürchten, auch woanders keine Milch mehr zu bekommen.
Mein Vater schilderte den Vorfall Herrn Slovaček, der vom Wahrheitsgehalt meiner Aussage überzeugt war. Ohne weitere Fragen ging er hinüber in den Milchladen und klärte die Angelegenheit. Ob er auch für den Schaden aufkam, weiß ich nicht. Meine Eltern wurden jedenfalls dieserhalb nicht belangt. Ohne seine Fürsprache hätte dieser Vorfall für unsere Familie schlimme Folgen haben können.
Die Slovačeks hatten selbst zwei Kinder, etwas jünger als ich, und brachten deshalb für den Wunsch meines Vaters, sich doch dafür einzusetzen, daß ich endlich wieder einmal eine Schule besuchen könne, großes Verständnis auf. Nach dem Ende des Krieges gab es für uns deutsche Kinder keine Unterrichtsmöglichkeit. Ich hatte also schon mehr als ein Jahr Schule versäumt. Wenn es schon keine deutschen Schulen mehr gab, so sollte ich wenigstens in die tschechische Schule gehen. Mitten aus der dritten Volksschulklasse war ich herausgerissen worden, irgendwie mußte der Anschluß wieder hergestellt werden. Herr Slovaček leitete das Erforderliche in die Wege und zu Beginn des nächsten Schuljahres sollte ich nochmals mit der dritten Volksschulklasse anfangen.
Der erste Schultag rückte näher, meine Angst vor dem Ungewissen wurde größer. Dann war es soweit. Mit einem kleinen Schreibheft und einem Bleistift ausgerüstet, mehr konnten mir meine Eltern nicht geben, betrat ich das beschriebene Klassenzimmer. Es handelte sich um eine gemischte Klasse. Ich wartete zunächst an der Tür ab, um zu sehen, ob jeder seinen bestimmten Platz habe. Dies schien nicht der Fall zu sein. Man setzte sich irgendwo und zu irgendwem hin. Also nahm auch ich in einer Bank neben fremden Kindern Platz. Niemand schenkte mir Beachtung.
Dann betrat der Lehrer das Klassenzimmer, begrüßte die Schüler im neuen Schuljahr und rief Namen und mir unverständliche Nummern auf. Als alle registriert waren, entstand eine Pause und in diese Pause hinein ertönten plötzlich die in einwandfreiem Deutsch gesprochenen Worte:
„Wir haben hier in unserer Klasse eine Deutsche, welche ist das?“
Dieser Frage hätte es nicht bedurft, denn der Lehrer wußte sehr wohl, daß ich die Deutsche war. Aus dieser Frage aber sprach ein Zynismus, der sogar mir - damals noch ein Kind - auffiel und sehr weh tat. Ich erhob mich. Gleichzeitig mit mir erhoben sich die Kinder vor, neben und hinter mir. Sie suchten sich andere Plätze. Ich saß allein, rings um mich herum Leere. Der Lehrer grinste. Die auf mich gerichteten Blicke der anderen Schüler waren wie Blitze. Nach all dem, was ich schon vorher auf der Straße und in den Geschäften erlebt hatte, konnte ich mir vorstellen, wie ich in dieser Klasse behandelt werden würde. Schon an diesem ersten Tag mußte ich damit rechnen, vor dem Klassenzimmer verprügelt zu werden, denn die Kinder waren von ihren Eltern aufgehetzt worden. Sie verhielten sich Deutschen gegenüber genauso wie die Erwachsenen. Ich hatte also nichts Gutes zu erwarten. Mit einer Unterstützung seitens des Lehrers brauchte ich nicht zu rechnen. Er hatte mir sein wahres Gesicht bereits gezeigt. Ich ließ den ersten Schultag über mich ergehen und als die Glocke ertönte, rannte ich mit meinem Heft und dem Bleistift aus dem Klassenzimmer und auf schnellstem Wege nach Hause.
„In diese Schule kann ich nicht mehr gehen, Vati“, rief ich meinem Vater, der mich erwartungsvoll an der Wohnungstür empfing, entgegen. „Ich habe Angst. Die schlagen mich doch nicht nur, die erschlagen mich doch. Es sind fast alles Jungen in der Klasse“, fuhr ich aufgeregt fort. „Wenn du die Blicke gesehen hättest, wie die mich angesehen haben. Die warten doch nur darauf, bis ich auf die Straße komme. Bitte, Vati, schick' mich nicht wieder in diese Schule. Kannst du nicht mit mir lernen?“ -
Meine Eltern besprachen sich, denn sie konnten sich gut vorstellen, wie meine Schultage in der tschechischen Schule abgelaufen wären.

Wieder ging Vater zu Herrn Slovaček und schilderten diesem meinen ersten Schultag. Slovaček bedauerte die Umstände. Als Tscheche aber wußte er, in welcher Gefahr ich mich einer Klassenmeute gegenüber befand und daß man mir als der einzigen Deutschen in der Klasse mit Sicherheit kaum eine Chance gegeben hätte, auch mit noch so guten Leistungen eine objektive Note im Zeugnis zu erhalten. Es war und blieb mein einziger Schultag in der tschechischen Schule, Herr Slovaček meldete mich wieder ab.
Zu all den Nöten, die meine Eltern bereits hatten, kam nun auch noch die Sorge um mich bzw. um meine schulische Ausbildung hinzu. Ich war 11 Jahre alt und hatte noch nicht einmal die dritte Volksschulklasse absolviert. Meine Eltern waren ratlos. Die Schule war für sie zum Problem Nummer Eins geworden. Und wie sollte ich je wieder Anschluß finden, wenn die unterrichtslose Zeit noch länger andauerte? All meine schon vor Jahren noch während der Kriegszeit vorgebrachten Wünsche brauchte ich jetzt gar nicht mehr wiederholen. Es gab wichtigere Dinge für mein Leben als den Eiskunstlauf, der mich schon immer fasziniert hatte, das Akkordeon, das Turnen. Und Bücher, Bücher. Ich las alles, was mir in die Hände fiel, zur damaligen Zeit natürlich am liebsten Sagen und Märchen. Doch wo gab es noch deutsche Bücher? Die Tschechen hatten jegliches deutsches Schrifttum vernichtet. Einiges an Lesematerial trieb ich bei meinen täglichen Streifzügen, meist in der Gegend um den Minoritenplatz, wo früher meine Großeltern lebten, auf. Wann immer die Tschechen verlassene, aber eingerichtete Wohnungen besetzten, warfen sie alles, was sie nicht benötigten, hinaus, um es zu verbrennen. Dazu gehörten natürlich vor allem deutsche Bücher. Einige konnte ich vor den Flammen retten, andere fischte ich aus der Oppa, sofern sie nicht schon total durchweicht waren. Zumindest auf diesem Gebiet blieb mein Geist rege und auch die Orthographie geriet nicht in Vergessenheit. Doch die Sorge um meine Aus- und Weiterbildung lastete schwer auf der Seele meiner Eltern.
Der Haß der Tschechen auf uns Deutsche hielt unvermindert an, ja er verstärkte sich sogar von Tag zu Tag. Ich konnte mir dieses Verhalten nie erklären, denn weder meine Eltern noch ich hatten den Tschechen jemals irgend etwas zuleide getan. In all den Jahren zuvor hatten wir, Deutsche und Tschechen, einträchtig in Jägerndorf zusammengelebt. Auch wenn ich nun die Ausdrücke „Nazischweine“ oder „deutsche Mörder“ hörte, hatte ich kein schlechtes Gewissen. Warum auch, ich war Kind. Auf meine diesbezüglichen Fragen den Eltern gegenüber wurde mir gesagt, daß weder Vater noch Mutter irgendeiner Organisation oder Partei angehört hatten. Vieles blieb mir unverständlich und konnte mir auch von den Eltern nicht erklärt werden. Ich glaube, sie wußten selbst nicht, warum sie plötzlich von den Tschechen so miserabel behandelt wurden.
Immer häufiger zogen Menschen mit ihrer wenigen Habe beladen durch die Straßen Richtung Bahnhof. Sie hatten sich für die Aussiedlung angemeldet und waren nun auf dem Abtransport Richtung Westen, also Deutschland. Auch mein Vater sprach während dieser Zeit oft vom „Aussiedeln“, aber auch davon, daß es Zeit sei, mich wieder in eine Schule zu schicken. Er hatte wohl auch mit seinem Arbeitgeber, Herrn Slovaček, über seine Absichten gesprochen, aber soweit ich das mitbekam, war Herr Slovaček von dieser Idee nicht begeistert. Er wollte meinen Vater behalten, er benötigte ihn. Und er versprach, sich einzusetzen, damit Vater bzw. unsere ganze Familie, die tschechische Staatsbürgerschaft erhalten sollte. Nur unter dieser Voraussetzung hätten wir weiterhin in Jägerndorf bleiben dürfen. Meine Eltern wollten jedoch keinen Wechsel ihrer Staatsbürgerschaft. Außerdem sahen sie weder für sich noch für uns Kinder eine gesicherte Zukunft. Ihre Pläne, Jägerndorf zu verlassen, nahmen immer festere Formen an.
Von den Dingen, die wir zur damaligen Zeit besaßen, gehörte uns eigentlich nichts. An unsere Ersparnisse, die auf der Jägerndorfer Sparkasse lagen, kamen wir nicht mehr heran. Die Sparbücher, Dokumente, Fotos, Einrichtungsgegenstände, Kleidung, Spielsachen, alles war in der Anzengrubergasse verblieben. Hier im Hause von Slovaček bedienten wir uns des Eigentums anderer Menschen. Die wenigen Dinge, die meinem Vater gehörten bzw. die er sich wieder neu angeschafft hatte und an denen er persönlich hing, versuchte er zu retten. Möglicherweise ist ihm das auch gelungen, doch überprüfbar ist das nicht mehr.
Das Haus am Masarykplatz, in dem wir nun wohnten, besaß außer einem Flachdach, von dem aus man den ganzen Platz, Rathaus, Stadtkirche und einen Teil des Parks sehen konnte, auch einen großen gemauerten Taubenstall, der sich oberhalb des Dachbodens befand. Mit der „Architektur“ des Taubenstalles hatte sich mein Vater eingehend befaßt und er war zu dem Ergebnis gekommen, daß man dort ein sicheres Versteck für seine ihm liebgewordenen Schätze - es handelte sich überwiegend um für damalige Verhältnisse wertvolle Fotosachen - anlegen könne. Vater ist davon ausgegangen, daß wir irgendwann wieder einmal nach Jägerndorf zurückkehren. Dann hätte er sich seine Dinge wieder holen können. Er hämmerte eine Seitenwand des Taubenstalles auf, baute in das Mauerwerk eine Nische, packte seine Gerätschaften sorgfältig ein und verschloß das Versteck so, daß man äußerlich nichts erkennen konnte. Der Taubenschlag wurde hinterher noch einmal schön getüncht. Sollte der Aufbau für die Tauben bis heute unberührt geblieben sein, dann befinden sich Vaters Fotoschätze noch in diesem Mauerwerk.
Obwohl die Slovačeks immer wieder versuchten, meinen Vater davon zu überzeugen, daß sich die Verhältnisse irgendwann für uns Deutsche ändern würden, entschieden sich meine Eltern für die Aussiedlung, auch wenn ihnen dieser Schritt sehr schwerfiel. Slovaček hatte sich schon so oft für unsere Belange eingesetzt, noch mehr konnte und durfte er nicht tun. Sie waren Tschechen, und in den Augen ihrer Landsleute hätten sie an Ansehen verloren bzw. wären geächtet worden, wären sie uns Deutschen noch weiter entgegengekommen.
Vater meldete uns zur Aussiedlung an. Das bedeutete, wiederum in einem Lager leben zu müssen, diesmal im Burgberg-, dem Aussiedlungslager. Jedem Aussiedler war es erlaubt, 20 kg Gepäck mitzunehmen. Mutter suchte all das zusammen, was sie für notwendig hielt. Dazu gehörten vor allem Decken, die allein schon ihr Gewicht mitbrachten. Ansonsten wurden nur einige Kleidungsstücke und etwas an Geschirr eingepackt, Gegenstände, die uns eigentlich nicht gehörten. Doch über die rechtmäßigen Besitzer dieser Wohnungen bzw. deren Einrichtung und Ausstattung war uns nichts bekannt. Wir hatten die Wohnung bzw. das ganze Haus, welches uns von Slovaček zur Verfügung gestellt worden war, mit aufgebrochenen Türen, verlassen und völlig durchwühlt, vorgefunden. Unser persönlicher Besitz, Dokumente, Fotografien und andere Andenken waren ohnehin in der Wohnung Anzengrubergasse verblieben. Da ich um meine Schlafpuppen weinte, zumal ich schon das ganze Puppenhaus mit Möbeln und den kleinen Schildkrötpuppen zurücklassen mußte - alles Spielzeug, welches wir in der Wohnung am Masarykplatz vorgefunden hatten - erhielt ich die Erlaubnis, Puppen und einige Märchenbücher mitzunehmen. Mit Sicherheit wären andere Dinge nützlicher gewesen, doch das konnte ich als Kind damals nicht beurteilen. Ich hing an meinen bescheidenen neuen Schätzen.
Den Abschied von Slovaček werde ich nie vergessen. Wir standen ein letztes Mal im Hausflur zusammen, unsere je 20 kg Gepäck um uns herum. Herr Slovaček blickte auf die Bündel und Koffer, dann auf uns, und plötzlich stiegen ihm Tränen in die Augen. Weinend reichte er uns, besonders innig aber meinem Vater, die Hände und drückte sie. Dann besann er sich, rannte zurück ins Geschäft und brachte ein Abschiedsgeschenk: Eine Dynamotaschenlampe, die ununterbrochen betätigt werden mußte, wollte man Licht haben. Zur damaligen Zeit war dies ein seltenes und wertvolles Stück. Vater nahm dieses Geschenk ergriffen entgegen. Dann rafften wir unser Gepäck auf und machten uns zu Fuß auf den Weg hinauf zum Burgberglager.
Das Aussiedlerlager am Burgberg
Auch dieses Lager, unterhalb der Burgbergkirche angelegt, war umzäunt und stand unter Bewachung. Wieder befanden wir uns in Holzbaracken, deren einziges Mobiliar aus hölzernen Stockbetten mit Strohsäcken bestand. Im Gegensatz zu den anderen Lagern, in denen wir bisher gelebt hatten, herrschte hier eine noch drängendere Enge, denn jeder der Insassen hatte seine 20 kg Gepäck in Form von geschnürten Bündeln und Koffern bei sich. Es herrschte gedrückte Stimmung. Nicht allein die Tatsache, daß man die Geburts- und Heimatstadt verlassen mußte, sondern auch die Ungewißheit vor der Zukunft bereitete den Menschen Sorge. Niemand wußte, wohin die Reise gehen würde. Ebenso wenig war bekannt, auf welche Weise sich solche Transporte abspielen.
Wir Kinder hatten uns schnell damit abgefunden, wiederum ein Lagerleben führen zu müssen. Diesmal war die Aufenthaltsdauer nicht von langer und unbestimmter, sondern von begrenzter Zeit. Den Tschechen war daran gelegen, möglichst viele Deutsche innerhalb kürzester Frist außer Landes zu befördern. Eigentlich wäre in diesem Lager eine Bewachung unnötig gewesen, denn wer sich einmal zur Ausreise entschlossen und sein Gepäck auf den Jägerndorfer Hausberg geschleppt hatte, war nicht an Flucht interessiert. Doch nach Meinung der Tschechen gehörte zu Lager und Stacheldraht auch bewaffnetes Bewachungspersonal. Damit konnte Macht und Stärke demonstriert werden.
Die Tage des Wartens vergingen für mich mit Spielen, Herumsitzen oder Lesen. Zweimal täglich durften wir Essen fassen. Es handelte sich dabei um die übliche dünne Suppe und Brot. Meine Puppen waren gut verpackt. Das Bündel wurde auch nicht mehr geöffnet, denn der Zeitpunkt unserer Abreise war nicht bekannt. Wir warteten.
Meine Eltern hatten sich mehrmals in der Verwaltungsbaracke einzufinden, es wurden Formulare ausgefüllt und sonstige bürokratische Dinge erledigt. Schwierigkeiten ergaben sich, wie bei manchen anderen auch, insofern, als wir über keinerlei Dokumente verfügten. Wir besaßen weder Geburtsurkunden noch irgendwelche Ausweise. All diese Unterlagen waren in der Wohnung Anzengrubergasse geblieben. Alles, worauf wir uns stützen konnten, waren Bescheinigungen bzw. „eidesstattliche Erklärungen“, welche Bekannte oder Verwandte abgegeben hatten. Meine Eltern fühlten sich recht- und staatenlos.
Auch wenn ich seinerzeit noch keine 12 Jahre alt war, so hatte diese bevorstehende Aussiedlung für mich große Bedeutung. Ich war in Jägerndorf geboren und aufgewachsen. Außer dieser Stadt hatte ich kaum einen anderen größeren Ort kennengelernt. Der Burgberg, auf dem sich dieses Lager befand, war mir von den Sonntagsspaziergängen her bekannt, er gehörte mit zu den häufigsten Ausflugszielen unserer Familie. Hier oben hatten wir im Sommer oft gesessen und der Musikkapelle, die an Festtagen in manchen Gaststätten spielte, zugehört. Hier erlaubten sich meine Eltern hin und wieder ein Gläschen Wein und ich durfte Limonade oder Kakao trinken, Eis oder Kuchen essen. An diese für mich damals schönen Zeiten erinnerte ich mich nun, als ich zum Wald und Richtung Burgbergkirche blickte.

In unserer übervoll belegten Baracke befanden sich zwei jüngere Frauen, die sehr schön singen konnten. An manchen Abenden, wenn sich alle schon auf ihre Strohsäcke niedergelegt hatten und das Licht gelöscht war, sangen sie ihre Lieder. Zum Repertoire gehörte auch „Heimat, deine Sterne“. In solchen Momenten gab es niemanden in der Baracke, der nicht weinte. Auch mir liefen die Tränen über die Wangen.
Eines Tages hieß es, sich für den Abtransport vorzubereiten. Es war mittlerweile Herbst geworden, die Bäume am Burgberg hatten ihr buntes Kleid angezogen. Der Natur standen mehr Farben zur Auswahl als uns an Kleidung. Soweit ich mich erinnere, besaß ich außer dem Kleidchen, welches ich am Leibe trug, nur noch ein weiteres zum Wechseln und ein dünnes schäbiges Mäntelchen. Ich hatte damals auch nur ein einziges Paar Schuhe, und zwar schwarze knöchelhohe Winterschuhe zum Schnüren. Es war unser letzter Abend im Burgberglager, am nächsten Morgen sollte es losgehen. In der Baracke herrschte reger Betrieb. Jeder suchte seine Sachen zusammen, um am darauffolgenden Tag keine Zeit zu verlieren. Da wir von unserem Gepäck kaum etwas ausgepackt hatten, benötigte meine Mutter für diese letzten Handgriffe keinerlei Hilfe. Ich schlenderte daher noch einmal durchs Lager und blieb dann an dem der Stadt zugewandten Zaun stehen. Von hier oben hatte man einen schönen Ausblick auf das gesamte Stadtbild, auf das in der Abendsonne glänzende Dach des Rathausturms, auf die vielen hohen Fabrikschornsteine. Mit den Augen suchte ich unsere Anzengrubergasse, den Park, die Schule. Wehmütig nahm ich das ganze Panorama in mich auf.
Die Gefühle, die mich damals bewegten, kann ich heute noch nachempfinden. In jenem Moment erschien mir meine Geburtsstadt, eingebettet in die umliegenden Hügel, so wunderschön, daß ich einfach nicht glauben wollte, all dies nicht mehr wiedersehen zu dürfen. Oder kommen wir vielleicht nach einer gewissen Zeit doch zurück? Niemand hätte mir diese Frage beantworten können. Keiner wußte, wie es weitergehen und was uns die Zukunft bringen würde.
Warum dürfen wir nicht hierbleiben? Warum behandeln uns die Tschechen so schlecht? Wohin würden wir morgen fahren? Wird es eine weite Reise sein? Kommen wir wieder in Lager oder werden wir künftig in Wohnungen leben? Was wird das wohl für eine Schule sein, die ich später besuche? Mit welcher Klasse fange ich wieder an?
Fragen über Fragen, die mir durch den Kopf schossen. Da stand ich nun, allein, und die Tränen kullerten mir über die Wangen. Ich kam mir plötzlich ganz verlassen vor, obwohl ich meine Eltern nur wenige Meter entfernt in der Baracke wußte. Mir kamen meine früheren Schulkameradinnen, meine Spielgefährten in den Sinn. Ich sah mich in der Wohnung Anzengrubergasse auf meinem Stühlchen neben dem Kachelofen sitzen, mein Lieblingsbuch, die Blunck-Märchen, auf dem Schoß. Wie oft hatte ich versucht, die darin abgebildeten ulkigen Figuren nachzumalen, was mir nie gelungen ist, denn Zeichnen gehörte nicht zu meinen Stärken. Der Trick mit dem dünnen Pauspapier hatte mir da schon eher weitergeholfen.
Erinnerungen und Gedanken hatten mich so gefangengenommen, daß ich nicht bemerkte, wie schnell die Abenddämmerung hereingebrochen war. Noch einmal ließ ich das Panorama an meinen Augen vorüberziehen, dann trocknete ich schnell meine Tränen und kehrte in die Baracke zurück. Vor meinen Eltern wollte ich nicht weinen, sie waren selbst traurig genug. Meine Mutter hatte ohnedies ständig feuchte Augen. In der Baracke herrschte inzwischen Ruhe. Die Mitbewohner hatten sich früh in ihre Betten zurückgezogen. Zum letztenmal sangen die beiden jungen Frauen „Heimat deine Sterne“, und diesmal schluchzten alle. Wann immer ich dieses Lied höre, bringe ich es gedanklich mit dem letzten Abend im Burgberglager in Verbindung. Seitdem sind 50 Jahre vergangen, meine Kinderzeit liegt lange zurück, aber die Tränen fließen nach wie vor, wenn ich an diese Augenblicke und an die verlorene Heimat denke.
Früh am nächsten Morgen standen wir - Hunderte von Menschen - in Reih und Glied am Lagertor. Das, was ich zu tragen in der Lage war, hatte Mutter mir aufgebürdet. Sie selbst schleppte neben ihrem Gepäck noch meinen kleinen Bruder, der den weiten Weg bis zum Bahnhof nicht zu Fuß geschafft hätte. Alles andere mußte sich mein Vater auf die Schultern laden.
Unter Bewachung trieb man uns zum Bahnhof. Mehrmals wurden wir von tschechischen Passanten beschimpft und bespuckt. Derartige Demütigungen waren wir mittlerweile gewohnt, auch wenn wir sie nicht begreifen konnten. Seit der Vertreibung aus der Wohnung haben wir immer nur dulden müssen, ohne uns jemals gewehrt zu haben. Wir haben nie aufbegehrt, sondern all die Schmach widerstandslos hingenommen. Auch während unserer letzten Schritte auf heimatlichem Pflaster mußten wir Hohn und Spott über uns ergehen lassen. Der Weg führte mitten durch die Stadt, also auch am Geschäft des Herrn Slovaček vorbei. Er hatte wohl bei bisher allen Aussiedlerkolonnen nach uns Ausschau gehalten. Diesmal waren wir dabei. Er winkte uns ein letztes Mal zu und ich sah, daß er seine Rührung kaum verbergen konnte. Meinen Eltern ging es ebenso. Slovaček hätte uns gerne dortbehalten, aber er wußte, daß Vater kein Tscheche werden wollte und wir als Deutsche keine Zukunft in unserer angestammten Heimat mehr hatten.
Am Bahnhof standen Viehwaggons bereit. Man befahl uns, einzusteigen. Jeder suchte sich irgendwo einen Platz auf dem Boden. Diejenigen, die einen Wandplatz erwischten, hatten wenigstens die Möglichkeit, sich anzulehnen. Die anderen mußten auf dem Boden hocken und hoffen, ohne große Rückenschmerzen die lange Reise zu überstehen. Wäre Vieh transportiert worden, hätte man die Waggons sicher noch mit Heu oder Stroh versehen. Wir hatten nichts, worauf wir uns setzen konnten, nicht einmal genügend Platz, um uns langlegen zu können. Nicht alle Waggons waren mit Türen versehen, bei einigen hatte man nur Ketten vorgelegt. Wir hatten das „Glück“, nach der Abfahrt die Schiebetür geschlossen zu bekommen und im Dunkeln sitzen zu dürfen. Arm dran waren diejenigen, die tage- und nächtelang dem Fahrtwind und dem Ruß ausgesetzt waren. Daß die Transporte von bewaffneten Bewachern begleitet wurden, versteht sich von selbst. Nach einer Wartezeit von mehreren Stunden setzte sich der Zug dann endlich in Bewegung. Etliche Tage und Nächte sollten vergehen, ehe wir nach ca. 1.000 km Fahrt unser Ziel erreicht haben würden.
Der Transport in Viehwaggons
Der Zug ratterte und ratterte. Nachdem wir im verschlossenen und dunklen Waggon saßen, wußten wir nicht einmal, wo wir uns befanden bzw. wie es draußen aussah. Irgendwann hielt der Zug an und es dauerte wieder Stunden, bis er sich erneut in Bewegung setzte. Während der langen Reise - übrigens die weiteste und längste, die ich mit meinen kaum 12 Jahren je gemacht hatte - gab es auch einige längere Pausen, in denen wir die Waggons verlassen durften. Dies geschah aber niemals auf einem Bahnhof, sondern irgendwo auf freier Strecke. Hier hatten wir dann auch Gelegenheit, unser mitgebrachtes Brot zu essen oder einen Schluck Wasser zu trinken. Diejenigen, die über keinerlei Nahrungsvorräte verfügten, stürzten sich - so vorhanden - auf die liegengebliebenen Früchte abgeernteter Felder neben den Gleisen. In dieser Notlage schmeckten sogar Futterrüben.
 Ein Vorkommnis wird mir immer in Erinnerung bleiben. Wieder einmal hatte der Zug angehalten. Wir kletterten nach draußen. Manche vertraten sich ein wenig die Beine, andere setzten sich an die Bahnböschung. Die Bewacher behielten uns ständig im Auge. Ein Entkommen wäre unmöglich gewesen. Ganz abgesehen davon hatte niemand eine Ahnung, in welcher Gegend wir uns befanden. Warum und wohin hätte man auch fliehen sollen?
Ein Vorkommnis wird mir immer in Erinnerung bleiben. Wieder einmal hatte der Zug angehalten. Wir kletterten nach draußen. Manche vertraten sich ein wenig die Beine, andere setzten sich an die Bahnböschung. Die Bewacher behielten uns ständig im Auge. Ein Entkommen wäre unmöglich gewesen. Ganz abgesehen davon hatte niemand eine Ahnung, in welcher Gegend wir uns befanden. Warum und wohin hätte man auch fliehen sollen?Die Weiterfahrt verzögerte sich, wie schon so oft. Es waren bereits mehrere Stunden vergangen und nichts geschah. Einige Männer aus den hinteren Waggons waren auf ein Nebengleis hinübergegangen und hatten sich dort auf die Bahnschwellen gesetzt. Niemandem war das Herannahen eines Güterzuges aufgefallen, niemand hatte etwas gehört. Plötzlich ertönten laute Schreie, ein Zug donnerte vorüber, und zurück blieben drei total zerfetzte Leichen. Wir Kinder wurden sofort in die Waggons zurückbefördert. Dennoch hörten wir das schreckliche Weinen und Wehklagen der Frauen, deren Männer auf diese Weise umgekommen waren. Der Schock über dieses schreckliche Ereignis verfolgte uns während der ganzen weiteren Fahrt.
Wieviele Tage wir unterwegs waren, ist mir nicht mehr erinnerlich. Fest steht, daß wir am 16. September 1946 die „Durchschleusungsstelle Furt im Wald“ passierten. Dort wurde uns ein Gesundheitsschein ausgehändigt, der folgende Eintragungen enthält:
„1. Der Inhaber dieses Scheines erhält nur gegen Vorlage desselben Zuzugserlaubnis, Lebensmittelkarten und Registrierschein.
2. Wer eigenmächtig den Transport verläßt oder sich bei dem zuständigen Flüchtlingskommissar nicht meldet, wird als vagabundierend erachtet und sofort in ein Arbeitslager verbracht.
3. Der Verlust dieser Bescheinigung ist umgehend dem Lagerleiter bzw. auf dem Transport dem Transportführer zu melden.“
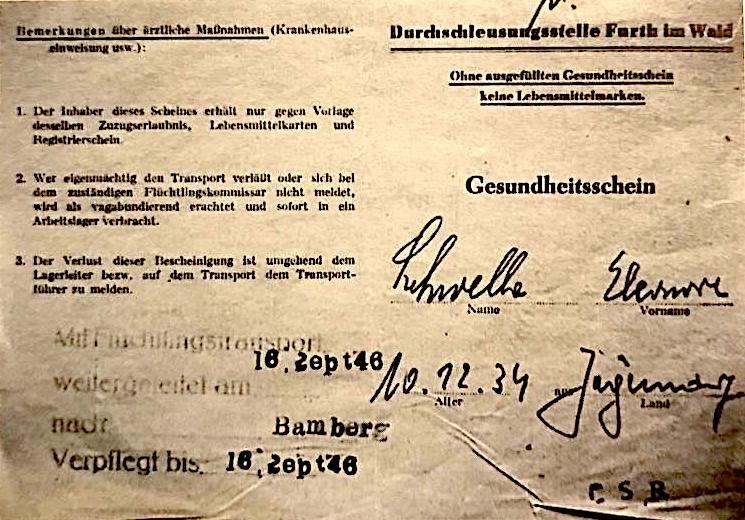
Weiterhin ist in dem Schein vermerkt, daß wir „verpflegt“ und mit DDT-Puder „entlaust“ wurden. Dieser Bescheinigung war auch zu entnehmen, ob man „frei von Ungeziefer, verlaust, ob einer schwach, mittel oder stark von Kopf- oder Kleiderläusen befallen ist, und ob man an Krätze oder Tuberkulose leidet.“ Ein Stempel „Mit Flüchtlingstransport weitergeleitet nach Bamberg“ zeigte uns wenigstens an, wohin die Weiterreise ging.
Das nächste Ziel war also Bamberg. Am dortigen Bahnhof angekommen, marschierte der ganze Treck mit den wenigen Habseligkeiten Richtung Stadtmitte. Ein Schulhaus war geräumt und als Unterkunft zur Verfügung gestellt worden. Wir lagerten, wiederum dicht an dicht, in Klassenzimmern zum Teil auf Strohsäcken auf dem Boden, zum Teil auf Pritschen. Die sanitären Anlagen des Schulhauses mußten zur notdürftigen Körperreinigung ausreichen. Hierfür standen nur die Kaltwaschbecken in den Toiletten zur Verfügung. Wir hatten keine Ansprüche und waren froh, wieder einmal mit Wasser in Berührung zu kommen, unsere Beine ausstrecken und eine Nacht durchschlafen zu können. Verpflegt wurden wir wie üblich mit trockenem Brot, Kaffee und Suppe aus großen Kesseln. Das Lagerleben waren wir mittlerweile schon gewohnt. Hier wurde wenigstens niemand mißhandelt. Ob wir nur mehrere Tage oder gar Wochen hier verbrachten, ist mir nicht mehr erinnerlich. Zwischendurch verließen immer wieder einige Gruppen dieses Behelfslager. Man sagte, sie würden auf verschiedene Orte verteilt und in Zimmer oder Wohnungen eingewiesen.
Eines Tages bekamen auch wir, zusammen mit etwa 40 bis 50 anderen Menschen den Auftrag, uns für den nächsten Tag bereitzuhalten. Wir würden weitertransportiert, hieß es.
Wieder marschierte der ganze Trupp mit Gepäck zum Bahnhof. Einige alte Menschen waren kaum noch in der Lage, diesen Fußmarsch mitzumachen. Jüngere, noch etwas kräftigere, luden sich das Gepäck der Alten zusätzlich auf ihre Schultern. Wir alle haben sicher keinen guten Eindruck auf die hiesige Bevölkerung gemacht. Ungepflegt, manche fast zerlumpt, mit abgetretenen Schuhen, so durchquerten wir die Stadt. Am Bahnhof angekommen, stand schon ein Zug bereit, der uns weiterbeförderte, und zwar nach Rothenburg ob der Tauber.
Das Lagerleben ging also weiter. In Rothenburg wurden wir im „Gasthof zur Glocke“ unweit des bekannten „Plönlein“ untergebracht. Der Gasthof war komplett geräumt worden, um Vertriebene im Gaststättenraum und Tanzsaal einquartieren zu können. Auch hier schliefen wir auf Strohsäcken auf dem Boden bzw. auf Feldbetten. Zwischen den Schlafstätten war jeweils nur ein schmaler Durchgang geblieben. Man mußte über Koffer und Bündel steigen, wollte man den Schlafplatz bzw. die Eingangstür erreichen. Im Raum selbst herrschte wiederum eine drückende Schwüle ob der vielen zusammengepferchten Menschen, Männer, Frauen, Kinder. Als Waschgelegenheit standen nur die damalige Waschküche des Gasthauses sowie die kleinen Wasserbecken in der Toilette zur Verfügung. Es ist leicht vorstellbar, in welchem Zustand wir uns alle befanden. Schwierigkeiten gab es auch bei der Notdurft. Für mehr als 50 Menschen waren höchstens drei bis vier Toiletten vorhanden. Es blieb nicht aus, daß des Nachts im gemeinsamen Raum zusätzlich noch mitgebrachte Eimer und Nachttöpfe, insbesondere für die Kinder, aufgestellt wurden. Der Geruch war entsprechend. Die Behältnisse wurden am Morgen geleert und mit frischem kaltem Wasser aufgefüllt. Das Wasser diente zum einen als Trinkwasservorrat, zum anderen aber auch als zusätzliche Waschgelegenheit.
Wenn man die damaligen Verhältnisse in unseren Massenunterkünften mit den heutigen in den Asylbewerberheimen vergleicht, dann leben die Asylsuchenden, die ihre Heimatländer freiwillig verlassen haben, im größten Luxus - und dennoch stellen sie Ansprüche. Wir dagegen waren aus unserer Heimat vertrieben worden und nun froh, überhaupt ein Dach über den Kopf und eine kärgliche Mahlzeit pro Tag zu erhalten. Wir erhielten keine Sozialhilfe, keine Freifahrscheine für öffentliche Verkehrsmittel, für Schwimmbäder und dergleichen, wir wurden nicht neu eingekleidet. Niemand von uns hätte sich damals ein eigenes Auto, einen Radioapparat, einen Telefonanschluß oder ähnliches leisten können. Oh, hätten wir uns erlaubt, das Essen vor die Tür zu kippen, weil es nicht unserem Geschmack entspricht - von derartigen Undankbarkeiten dem Gastland gegenüber liest man fast täglich in den Tageszeitungen - man hätte uns nichts mehr zugeteilt. Im Gegensatz zu den heutigen „Flüchtlingen“ waren wir hungrig und ausgezehrt und froh über jeden Bissen Brot, den man uns reichte. Jede auch noch so kleine Hilfe, die uns Mitmenschen zuteil werden ließen, machte uns glücklich.
Der Aufenthalt in Rothenburg muß sich wohl über einen längeren Zeitraum hingezogen haben, denn meine Eltern meldeten mich bei der dortigen Schule zum Unterricht an. Nur wenige Wochen, dann sollte ich 12 Jahre alt werden. Wegen der fehlenden zwei Schuljahre war ich nun schon um einiges älter als die anderen Kinder, welche die dritte Volksschulklasse besuchten. Und genau in diese Klasse hätte ich auch wieder gehen müssen, um den Anschluß zu bekommen. Mit wenig Begeisterung machte ich mich auf den Weg zur Schule. Mein Interesse, welches ich früher immer für den Unterricht gezeigt hatte, war nach und nach geschwunden. Die Kinder und Lehrer waren mir fremd. Mit meinen abgerissenen Kleidern, still und verstört, wie ich mittlerweile geworden war, fand ich keinen Anschluß. Außerdem verstand ich den fränkischen Dialekt nicht. Hinzu kam, daß man mich ständig zwischen den Klassen hin- und herschob. Zunächst hatte man mich in die dritte Klasse gesetzt, da ich aus dieser ja herausgerissen worden war, aber festgestellt, daß ich hier wohl fehl am Platze sei. Trotz der fehlenden Jahre schien ich keine Wissenslücken gehabt zu haben. Man holte mich zu meinen Altersgenossen in die 5. Klasse, doch dort war ich überfordert. Es war sowohl mein Wunsch als auch der meiner Eltern, daß ich meinen früheren Leistungen entsprechend eine höhere Schule besuchen sollte. Das Alter dazu hatte ich erreicht, ja sogar schon überschritten. Es wurde mit der Schulleitung geredet und verhandelt, doch ohne Ergebnis. In der Zwischenzeit pendelte ich nach wie vor zwischen der dritten, der vierten und der fünften Volksschulklasse herum, lernte dabei aber so gut wie nichts.
Das Schulproblem sollte bald eine andere Lösung finden. Man eröffnete uns, daß die einzelnen Familien nunmehr auf Dörfer im Umkreis von Rothenburg verteilt werden sollten. Ca. 15 Jägerndorfer Familien fanden in Endsee, einem kleinen Dorf bei Rothenburg o.T., eine vorläufige Bleibe.
Einweisung der Vertriebenen: Endsee
Die Bahnfahrt von Rothenburg o.T. bis nach Endsee dauerte nur kurze Zeit. Das „Bahnhofsgebäude“ von Endsee bestand aus einer offenen Bretterbude, abseits vom Dorf und mitten im Wald gelegen. Daran konnte man schon erkennen, in welch großem Ort wir einquartiert werden sollten.
Ein Beauftragter der Gemeinde erwartete uns am Zug und geleitete uns durch den Wald, über Feldwege, nach Endsee, unserem künftigen Zuhause. Fast jede der einheimischen Bauernfamilien war verpflichtet worden, Räume für „Flüchtlinge“, so wurden wir Vertriebenen bezeichnet, bereitzustellen. So zog unser Jägerndorfer Trupp mit Kindern und Gepäck durchs Dorf, dessen Häuser und Gehöfte sich beidseitig entlang der unbefestigten Durchgangsstraße reihten. Nach und nach verringerte sich die Zahl der Einzuweisenden. Wir gehörten zu dem kleinen übriggebliebenen Häufchen Menschen, die noch bis fast ans Ende des Dorfes begleitet wurden. Dann standen wir vor einem soliden hellen einstöckigem Haus aus großen Muschelkalksteinen, dessen Fenster mit Blumenkästen geschmückt waren.
Am Hoftor befand sich ein Nußbaum, darunter eine Bank. Den weitläufigen Hof zierte ein großer Misthaufen. Gegenüber dem Hauptgebäude befand sich noch ein etwas kleineres Haus, das sogenannte Ausgedinge, mit einem danebenliegenden schönen Blumengarten. Die Scheunentore waren geöffnet, aus den Ställen hörte man das Schnauben der Pferde und das Blöken der Rinder. Nie zuvor war ich auf einem Bauernhof gewesen. Mir gefiel diese Idylle.
Bauer und Bäuerin empfingen uns freundlich und luden uns in die „gute Stube“ ein, wo wir mit Kaffee und Kuchen bewirtet wurden. Einen solchen Empfang hatten wir nicht erwartet. Es tat gut, wieder einmal in einem schönen Zimmer, beheizt durch einen großen Kachelofen, an einem Tisch sitzen zu können. Wir waren angenehm überrascht. Die Besitzer dieses Hofes - der Bauer selbst war zur damaligen Zeit Bürgermeister des Ortes - hatten in etwa das gleiche Alter wie meine Eltern. Meine Mutter war zu jenem Zeitpunkt 33, mein Vater 36 Jahre alt. Die beiden Töchter der Landwirte waren etwas jünger als ich.
Natürlich interessierten sich unsere künftigen Hausherren für unsere Herkunft, für den Beruf meines Vaters, auf welche Weise wir gerade in diesen Ort verbracht worden waren und anderes mehr. Meine Eltern gaben bereitwillig Auskunft. Ich saß still dabei, aß den Kuchen, und stopfte zwischendurch auch meinem kleinen Bruder einen Bissen in den Mund. Zum einen hatte ich wiederum Schwierigkeiten, den Dialekt dieser Menschen zu verstehen, zum anderen war ich mittlerweile dermaßen still und in mich gekehrt geworden und hatte Hemmungen, mich in irgendeiner Weise zu äußern.
Während des Gespräches erfuhren wir, daß im gleichen Hause bereits eine Flüchtlingsfamilie, ebenfalls zwei Erwachsene und zwei Kinder, aus Siebenbürgen untergebracht war.
Die Besitzer des Hofes, bestehend aus nur vier Personen, waren also verpflichtet worden, Raum für weitere acht fremde Menschen, von denen sie so gut wie nichts wußten, zur Verfügung zu stellen. Sie selbst hatten sich in ihrem eigenen Hause einzuschränken. Welche Gefühle und welche Gedanken müssen die Einheimischen seinerzeit wohl bewegt haben. Es war sicher nicht einfach für sie, ihr Haus plötzlich mit weiteren acht Personen teilen zu müssen. Wie sich später herausstellte, hatte man mit den Aussiedlern aus Siebenbürgen nicht gerade die besten Erfahrungen gemacht. Zwar waren diese Menschen lieb und nett, doch kamen sie aus einem völlig anderen Kulturkreis als wir. Sie sprachen ihre eigene Sprache, trugen ihre Tracht, hatten andere Koch-, Eß- und Waschgewohnheiten und stammten wohl aus einem Dorf, in dem die Zivilisation noch nicht allzuweit vorangeschritten war. Das äußerte sich schon in der Art, wie sie ihr Zimmer sauberhielten. Ein Eimer Wasser wurde über die Holzdielen geschüttet und die Fluten anschließend mit einem Reisigbesen aus dem Raum, über die Diele und die Treppen hinuntergefegt. Diese Naßprozedur und andere Dinge mehr mißfielen selbstverständlich den Hausbesitzern, zumal die Holzfußböden einschließlich der Treppen durch das ständige Wasseraufgießen erheblich litten. Daß sich die Hauseigner, ich möchte sie Familie „K.“ nennen, nun Gedanken und Sorgen hinsichtlich unserer Angewohnheiten und Eigenarten machten, zumal sie noch keine Erfahrungen mit den in allen Beziehungen wesentlich fortschrittlicheren Sudetendeutschen hatten, versteht sich von selbst.
Das einstöckige Haus enthielt nicht allzuviel Wohnfläche. Zur damaligen Zeit mußten noch Knechte und Mägde mit untergebracht werden. Nun waren zusätzlich weitere Menschen einquartiert worden, die im Haus ein- und ausgingen, den gleichen Flur, das gleiche Treppenhaus benutzten.
Sowohl den Siebenbürgern als auch uns war ein Stübchen im Obergeschoß zugewiesen worden. In unserem Raum befanden sich zwei mit Strohsäcken versehene Betten, eines davon mit Überbreite. Das normale Bett wurde von meinem Vater, das breite von meiner Mutter zusammen mit meinem inzwischen 4 Jahre alt gewordenen Bruder belegt. Ich schlief zunächst auf einem Strohsack auf dem Boden. Später hatten wir die Möglichkeit, von den Amerikanern ein Feldbett zu erstehen, auf das wir den Strohsack legten, so daß auch ich eine ordentliche und bequeme Liegestatt erhielt. Unsere wenigen Habseligkeiten verstauten wir in einem uns zur Verfügung gestellten Schrank und einem Kästchen. Ein kleiner Kanonenofen, der gleichzeitig als Küchenherd dienen mußte, wärmte den Raum. Ein Tisch und drei Stühle vervollständigten die Einrichtung. Mein „Bett“ diente tagsüber als zusätzliche Sitzgelegenheit. Auch wenn das Zimmer damit nur spartanisch ausgestattet war, hatten wir mit vier Personen wenig Platz, um uns darin zu bewegen. Da sich zur damaligen Zeit noch keine Wasseranschlüsse in den Gebäuden befanden, mußte das Wasser vom Dorfbrunnen, wo zum Teil auch das Vieh getränkt wurde, herangeschafft werden. So stellten wir im Zimmer einen sogenannten Wasser- und einen Schmutzwassereimer auf. Natürlich fehlte nicht die Zinkwanne für das „wöchentliche Bad“. Entsprechend oft liefen wir mit den Eimern treppauf, treppab, um Schmutzwasser wegzubringen und Frischwasser zu holen. Da die Familie aus Siebenbürgen ihren Wasserbedarf auf die gleiche Weise austauschte, war in dem Haus ein ständiges Kommen und Gehen. Durch diesen Umtrieb haben wir, die Fremden, den Besitzern, die bisher in ihrem eigenen Haus Ruhe gewohnt waren, unbeabsichtigt zwar, aber immerhin ziemlich viel zugemutet.
Der jeweilige Weg zur Toilette kann als kleine Wanderung bezeichnet werden. Das galt aber nicht nur für uns Vertriebene, sondern auch für die Bauern selbst. Da, wie bereits erwähnt, in den Häusern des Dorfes noch keine Wasseranschlüsse vorhanden waren, gab es auch keine Toiletten mit Wasserspülung. Das Toilettenhäuschen, eine zugige Bretterbude, befand sich am anderen Ende des Gehöfts. Man mußte zunächst durch den Hof, am Schweinestall vorbei, durch eine weitere Scheune gehen und erreichte dann das „berühmte Loch im Holzbrett“. In der Regel saß der Besucher nicht einsam und allein im Häuschen, denn die Hühner gackerten, scharrten und pickten in den Fäkalien herum, die man unter sich hatte fallen lassen. Unangenehm war dieser weite Weg insbesondere des Nachts und im Winter. Man wanderte mit Kerze oder Taschenlampe und kehrte total durchgefroren wieder ins Bett zurück. So waren nun mal die Verhältnisse in jenen Jahren.
Das Heizmaterial für den Zimmerofen besorgten wir uns im Wald, indem wir Zweige und Zapfen zusammensuchten. Schwierigkeiten mit dem Brennmaterial gab es naturgemäß bei nassem Wetter und während der Wintermonate, denn dann mußten wir in unserem kleinen Zimmerchen auch noch einen gewissen Holzvorrat unterbringen, um ihn trocknen zu können. Als uns später etwas mehr Geld zur Verfügung stand, konnten wir Holz als gesamten Ster kaufen. Damit begann für mich schon die Schwerarbeit, denn das Holzhacken und Spänemachen gehörte mit zu meinen Aufgaben.
Lange Zeit blieb mein Vater, so wie die anderen Vertriebenen auch, arbeitslos. Wir besaßen nichts. Kein Geld, kaum Kleidung, keine Vorräte. Mein einziges Paar Strümpfe war von mir mittlerweile schon so oft gestopft worden, daß die Vorderseite vom Knie bis hinunter zu Spitze und Fersen nur noch aus Stopfgarn bestand. Die Sohlen meiner knöchelhohen schwarzen Schnürschuhe waren durchgelaufen. Ich hatte sie Sommer und Winter getragen. Meine Eltern waren nicht besser dran. Familie K. hatte wohl ein Einsehen mit mir, zumal sie meinen erbärmlichen Zustand mit dem ihrer eigenen Kinder vergleichen konnte. Zu irgendeinem Anlaß schenkte mir die Bäuerin ein Paar neue Strümpfe und eine Schürze. Als ich mit diesen Geschenken zu meiner Mutter kam, weinten wir beide vor Freude. Meine Eltern haben immer versucht, andere so wenig wie möglich mit unserem eigenen Leid zu konfrontieren und Gefühle und Empfindungen nicht zu zeigen. Ständiges Jammern hätte an unserer Situation ohnedies nichts geändert, es hätte allenfalls als Bettelei ausgelegt werden können - und betteln wollten wir nicht.
Die ersten Monate, die wir in Endsee verbrachten, waren die erbärmlichsten und ärmsten unseres ganzen Lebens. Täglich zog uns der Küchenduft der Bauernfamilie in die Nase. Zur Vesperzeit saßen alle, Bauern, Knechte und Mägde, um den großen Tisch in der Diele und verzehrten ihr Brot, Schinken und Most. Da der Weg aus dem Haus stets durch diese Diele führte, blieb uns dieser Anblick nicht erspart. Um all die schönen Dinge nicht sehen zu müssen, wandten wir unseren Blick im Vorbeigehen gern nach der anderen Seite. Ich bin überzeugt, daß unsere Bitte nach einem Stück Brot oder Schinken nicht abgelehnt worden wäre, denn wir hatten das Glück, bei besonders verständnisvollen und entgegenkommenden Bauern einquartiert worden zu sein. Doch es lag uns fern, dieses Wohlwollen uns „Eindringlingen“ gegenüber auszunutzen. Natürlich litten wir oft unter Hunger, weil uns die zur Verfügung stehenden Nahrungsmittel nicht ausreichten, um reichhaltige Essensportionen auf den Tisch zu bringen. Zum Einkauf fehlte das Geld. Also war der Ausspruch „bei uns ist heute wieder „Schmal-Hans Küchenmeister“ zur täglichen Devise geworden. Meine Eltern hätten niemals um etwas zu Essen gebeten und ich war ermahnt worden, „nicht gierig auf die Teller anderer zu sehen“. Irgendein bescheidenes Mahl kam auch auf unseren Tisch, wenngleich wir von der aufgetischten Menge nicht immer satt wurden.
Familie K. muß von der Ehrlichkeit der ihr zugewiesenen Vertriebenen wirklich überzeugt gewesen sein und hegte keinerlei Mißtrauen. Niemals wurde eine Tür abgeschlossen, weder die zu den Zimmern noch die zur Küche. Die Bauern verließen das Haus, um zur Feld- oder Gartenarbeit zu gehen, sie hielten sich in den Ställen oder den Scheunen auf, und das Haus mit allem, was sich darin befand, wäre uns zugänglich gewesen.
Weder wir Kinder noch unsere Eltern haben während der Abwesenheit der Familie K. jemals ein Zimmer außer dem uns zugewiesenen betreten. Wir empfanden dieses gegenseitige Vertrauen als sehr wohltuend. Während all der Zeit, in der wir in diesem Hause lebten, hat es nie Zerwürfnisse irgendwelcher Art zwischen uns gegeben. Wir schätzten unsere Vermieter und waren dankbar für jedes freundliche Wort, für jede Zuwendung. Im Laufe der Zeit entwickelte sich zwischen den Hausbesitzern und uns ein fast freundschaftliches Verhältnis. Für die einheimische Bevölkerung war es sicher nicht einfach, von heute auf morgen, und dazu noch auf unbestimmte Zeit, einen großen Teil ihrer eigenen Wohnfläche fremden Menschen zur Verfügung stellen und auch deren tägliche Aktivitäten hinnehmen zu müssen.
In Anbetracht der Tatsache, daß die meisten Vertriebenen zum damaligen Zeitpunkt noch ohne Beschäftigung waren, wurden wir von der Gemeinde verpflichtet, bei den Arbeiten der Flurbereinigung und beim Sammeln von Kartoffelkäfern mitzuhelfen. Geführt von den Einheimischen, zogen wir in Gruppen über die Felder und kamen diesen Tätigkeiten nach.
Auf diese Weise erhielten wir Kenntnis über die Anbauflächen und deren Bewuchs. Mit Genehmigung der Bauern durften wir Vertriebenen später auf den abgeernteten Feldern nachlesen. Diese Erträge bereicherten unseren Speisezettel ungemein. Nun verfügten wir über Kartoffeln, Ähren für Mehl, Mohn für Kuchen, Rüben für Sirup. Daß sich unter den Vertriebenen, sowohl den Sudetendeutschen als auch den Siebenbürgern, „schwarze Schafe“ befanden, soll nicht verheimlicht werden. Nicht immer blieb es nur bei der Nachlese. Manchmal wurde auch „richtig geerntet“, sehr zum Unmut derer, die auf ehrliche Art und Weise die Felder nach Resten absuchten und ihren guten Ruf gewahrt wissen wollten. Es blieb auch nicht aus, daß hin und wieder aus den Ställen der Bauern ein Huhn oder ein Kaninchen verschwand. Zum Glück hielten sich derartige Vorkommnisse in Grenzen. Sehr schnell hätte das im allgemeinen gute Ansehen der in diesem Dorf einquartierten Vertriebenen geschädigt werden können.
Nachdem die Vertriebenen nun über einige Lebensmittelvorräte verfügten, konnten auch Tauschgeschäfte getätigt werden. Man tauschte z. B. Kartoffeln gegen Stoff oder Wäsche, Mohn oder Karotten gegen Töpfe und Schüsseln. Auf diese Weise gelang es so manchem, seinen Haushalt ein wenig zu vervollständigen. Unter uns Jägerndorfern gab es auch einige Fachkräfte, die sich dank ihres erlernten Berufes nützlich machten, sei es als Schneiderin, Schreiner, Mechaniker, oder - wie mein Vater - Elektriker. Mit ihrer Hände Arbeit verdienten sie sich manchmal neben Lebensmitteln auch ein wenig Geld. So konnten auch wir uns so nach und nach notwendige Kleinigkeiten anschaffen.
Zunächst war es jedoch wichtig, mein Schulproblem zu lösen. Wie schon erwähnt, war mein Vater lange arbeitslos. Den Besuch einer höheren Schule, die es allenfalls in Rothenburg oder Ansbach gab, hätte er mir nicht ermöglichen können. Allein die täglichen Fahrtkosten hätten jeden Rahmen gesprengt. Zum anderen mußte dem Umstand Rechnung getragen werden, daß ich bereits 12 Jahre alt war, aber bisher erst die Hälfte der dritten Volksschulklasse und dann zwei Jahre gar keine Schule mehr besucht hatte. So blieb nur die Möglichkeit, zunächst zusammen mit den einheimischen Kindern die ca. 3 km entfernt liegende Volksschule in Steinach/Ens zu besuchen. Ich schämte mich, mit meinen 12 Jahren bei den 10jährigen in der dritten Volksschulklasse sitzen zu müssen. Doch es stellte sich bald heraus, daß die Schulpläne im Sudetenland andere Inhalte gehabt haben müssen. Trotz der verlorenen zwei Jahre hatte ich keine Schwierigkeiten mit dem Lehrstoff, so daß ich innerhalb weniger Wochen schon eine Klasse weiterrücken durfte.
Schwierigkeiten bekam ich allerdings mit dem damals alten Dorfschullehrer, der offensichtlich nicht allzugut auf die „Flüchtlinge“ zu sprechen war. Trotz Anstrengung und - wie ich meine - guter Leistungen, war mein erstes Zeugnis in dieser Klasse niederschmetternd, während einheimische Mitschüler die besseren Noten nach Hause trugen. Der Grund war sehr schnell gefunden. Nach dem Kriege benötigte jeder Lebensmittel, auch ein Dorfschullehrer. Wir Vertriebenen konnten keine Eier, keinen Speck, keinen Schinken, kein frischgebackenes Brot liefern. Damit erklärte sich auch die ungerechte unterschiedliche Benotung. Erst als mein Vater einmal zu irgendeiner Reparatur an der elektrischen Leitung ins Haus dieses Lehrers gerufen wurde, änderten sich die Zensuren in meinem Zeugnis.
Durch die schnelle Versetzung von der dritten in die vierte Klasse hatte ich nun ein Jahr aufgeholt. Mein nach wie vor bestehender Wunsch, eine höhere Schule besuchen zu dürfen, war aber immer noch nicht verwirklicht. Mittlerweile war es meinem Vater zwar gelungen, in Rothenburg eine Arbeit zu finden, doch hatte meine Familie derartigen finanziellen Nachholbedarf, daß für meine schulischen Ambitionen kein Geld zur Verfügung gestellt werden konnte. Trotzdem zog mein Vater beim Rothenburger Schulamt Erkundigungen ein. Die Auskünfte waren jedoch nicht gerade ermutigend. Zum einen - so wurde ihm gesagt - fehle mir immer noch ein ganzes Schuljahr, was ich erst nachholen müsse. Erst dann würde sich herausstellen, ob ich für die höhere Schule geeignet sei. Zum anderen hätte ich dann aber schon die Altersgrenze für den Eintritt in die Oberschule bzw. das Gymnasium überschritten. Nun, vielleicht hätte man auch in diesem Falle mit Eier und Speck etwas erreichen können, aber wir waren nun mal nur arme Vertriebene. So trabte ich also weiter mit meinen zerschlissenen Schuhen im Winter, und barfuß im Sommer, zusammen mit den anderen in die Steinacher Dorfschule.
Meine Einstellung zur Steinacher Schule änderte sich mit einem Lehrerwechsel. Der alte Dorfschullehrer wurde durch einen jüngeren ersetzt, der - wie sich herausstellte - ebenfalls Vertriebener aus dem Sudetenland war. Der neue Lehrer namens „T.“ setzte seinen ganzen Ehrgeiz ein, dieser Dorfschule einen neuen Ruf zu verschaffen. Im Sudetenland ausgebildet, verfügte er über ein umfangreicheres Wissen, das er gern an seine Schüler weitergeben wollte. Ich bin überzeugt, daß auch Lehrer T. geschenkte Eier nicht zurückgewiesen hat, aber er behandelte und zensierte gerecht, ohne Unterscheidung nach eigenem Vorteil oder nicht. Er hielt sich mit Sicherheit auch nicht streng an den ihm vorgegebenen Lehrplan, sondern versuchte, uns darüber hinaus noch Wissen zu vermitteln, welches normalerweise nicht an einer Dorfschule gelehrt wird. Ein Steckenpferd von ihm waren kompliziertere Formen in der Raumlehre, das Wurzelziehen, chemische und physikalische Experimente, sein Geographieunterricht umfaßte die ganze Welt, der Naturkundeunterricht wurde sehr ausgeweitet und dem Musikunterricht mit Gesang räumte er großen Raum ein. Aber nicht nur das. Er scheute sich nicht, uns alle, ob Vertriebene oder Bauernkinder, vortreten und unsere Fingernägel vorzeigen zu lassen. Er wies darauf hin, daß auch ein Bauernkind, so schwer dessen Mitarbeit auf dem Hof auch sein mag, die Zähne zu pflegen und den Hals zu waschen hat. Lehrer T. wurde von allen, insbesondere von mir, sehr geschätzt und er hat diese Wertschätzung auch verdient. Es stellte sich später heraus, daß Schulabgänger der Steinacher Schule über ein wesentlich umfangreicheres Wissen verfügten als die anderer Dorfschulen.
Obwohl ich in dieser Schule und aus diesem Unterricht viel profitiert habe und abermals ein ganzes Schuljahr überspringen durfte, um altersmäßig wieder richtig eingeordnet zu sein, ist mir der Besuch einer höheren Schule verwehrt geblieben, was sich für mein weiteres Leben sehr zum Nachteil ausgewirkt hat. An ein Studium war nicht mehr zu denken. Meinen Eltern ging es jetzt darum, mir zwar eine gediegene Ausbildung angedeihen zu lassen, aber eine rasche, damit ich möglichst bald einer Tätigkeit nachgehen und eigenes Geld verdienen konnte. Meine Wünsche, wie z. B. das Besitzen und Erlernen eines Instrumentes - mein Herz hing nach wie vor an einem Akkordeon - sowie das als Kind so gern geübte Schlittschuhlaufen fortsetzen und gezielt Sport treiben zu können, mußte ich aus meinem Gedächtnis streichen. Meine Eltern besaßen gerade so viel, um uns einigermaßen ernähren zu können. Nachdem mein Vater wieder in Brot und Arbeit stand, benötigte zunächst er Kleidung, denn so abgerissen, wie wir in Endsee angekommen waren, konnte er seiner Beschäftigung nicht nachgehen.
Der tägliche Fußweg von Endsee zur Schule nach Steinach und zurück, Schulaufgaben, Hilfe im kleinen Haushalt usw. nahmen schon einen gewissen Zeitraum in meinem Tagesablauf ein. Daneben aber entdeckte ich meine Liebe zur Landarbeit. Freiwillig half ich bei der Fütterung und beim Ausmisten im Stall mit. Wöchentlich wurden den Kühen die Schwänze gewaschen. Ich nahm der Magd diese Arbeit ab. Nach und nach lud ich mir selbst immer mehr Aufgaben auf und betrachtete meine Mitarbeit in Stall und Scheune bald als eine Selbstverständlichkeit. Nicht bedacht hatte ich allerdings meine körperliche Konstitution und die Tatsache, daß wir durch die langen Entbehrungen unterernährt waren und unserem Körper wertvolle Aufbaustoffe fehlten. Auch wenn es mir schwerfiel und ich häufig Schmerzen im Kreuz verspürte, ließ ich es mir nicht nehmen, den schweren Mistkarren aus dem Stall über ein Brett auf den Misthaufen zu schieben und dort umzukippen. Ich plagte mich auch mit den schweren Futterkarren, die von der Scheune die Rampe hoch- und in den Stall zu fahren waren. Auch bei der Vorbereitung des Schweinefutters machte ich mich nützlich, wurden doch dafür Kartoffeln gekocht, wovon auch einige für mich abfielen, die ich dann mit Salz bestreute und gierig in mich hineinschlang. Ich kümmerte mich um die Fütterung des einen Hofhundes, um die Kaninchen, half bei der Ernte auf dem Felde mit, beteiligte mich am Heueinfahren und selbstverständlich bei der Hauptarbeit im Herbst, beim Dreschen. Auch da übernahm ich Arbeiten, die offensichtlich meine Kräfte überschritten, und zwar das Hochhieven von Strohgarben mittels langer Gabeln auf die oberen Etagen der Scheune, wo ich dann später auch noch das Festtreten übte. Die Landarbeit begeisterte mich. Ich fühlte mich der Bauernfamilie schon fast zugehörig. Im Gegensatz zu anderen Vertriebenen, die mit ihren „Vermietern“ nicht ganz zurechtkamen, fühlten wir uns bei „unserer Landwirtsfamilie“ wohl. Es gab nichts, was unser gutes Einvernehmen hätte stören können.
Meinem kindlichen Rücken muß schon das frühere Herumtragen meines kleinen schwachen Bruders nicht allzu gut getan haben. Später folgte das Schleppen der schweren Holzklötze, das Holzhacken, das Tragen der Wassereimer. Nun hatte ich mir aber noch diese Landarbeiten aufgebürdet, ohne an Folgen zu denken. Doch welches Kind denkt schon an spätere körperliche Gebrechen, wenn es Freude an der Arbeit hat - und die Arbeit auf dem Hof und Feld bereitete mir Freude. Auch die Erwachsenen machten sich keine Gedanken über evtl. Konsequenzen. Auf dem Lande hatte man schon immer schwer gearbeitet und meine Eltern hatten in ihrer Jugendzeit ebenfalls hart zupacken müssen. Warum also sollte man mich zurückhalten, wenn ich begeistert mithalf und stolz auf meine körperliche Stärke und Leistungen war?
Die Schulzeit neigte sich ihrem Ende zu. Meine Eltern waren sich über meine berufliche Zukunft immer noch nicht schlüssig. Zum einen war ich eine gute Schülerin und hatte gewisse Ambitionen, die man mir nicht verwehren wollte. Zum anderen aber sprachen die Zeiten und Umstände dagegen. Wären die Verhältnisse nach dem Kriege in der Heimat andere gewesen, hätte auch mein künftiges Leben einen anderen Verlauf nehmen können. Nach der Vertreibung mußten meine Eltern nun versuchen, das Beste aus dem zu machen, was sich ihnen bot.
Ich war 14 Jahre alt und hatte insgesamt 6 Jahre Schulzeit hinter mir. Was nützten meine gute Auffassungsgabe und mein Lerneifer, wenn keine Möglichkeit bestand, mich ausbilden oder mich eine Lehre durchlaufen zu lassen? In Endsee und Umgebung, also einer völlig ländlichen Gegend, hätte ich allenfalls als Magd unterkommen können. Die nächsten Städte, in denen evtl. Arbeitsplätze zu finden gewesen wären, waren Rothenburg ob der Tauber, oder noch weiter, Ansbach/Mittelfranken. Welche Chancen boten sich einem 14jährigen Mädchen mit sechs Volksschuljahren?
Obzwar wir nur „Flüchtlinge“ und arm waren, zudem mit 4 Personen in einem kleinen Zimmerchen leben mußten, hatten meine Eltern dennoch einen gewissen Stolz und Ehrgeiz. Es ging nicht an, daß sie ihre einzige Tochter als Magd verdingen sollten, auch wenn dies als ehrbare Arbeit bezeichnet werden kann. Sie hatten sich durchgerungen, noch zwei Jahre auf zusätzliche finanzielle Hilfe zu verzichten, weitere Entbehrungen auf sich zu nehmen, und mir den Besuch der Städtischen Handelsschule in Ansbach zu ermöglichen. Es wurden die notwendigen Formalitäten in die Wege geleitet.
Dem Tag der Aufnahmeprüfung sah ich mit großer Angst entgegen. Zum einen war ich während all der vergangenen Jahre nicht ein einziges Mal aus dem Dorf Endsee hinaus-, geschweige denn in eine größere Stadt gekommen, schon gar nicht allein mit dem Zug gefahren. Nun sollte ich mich, eine Dorfschülerin, einer Prüfung stellen, der sich überwiegend Schülerinnen aus Stadtschulen, vor allem aber aus Oberschul- und Gymnasiumklassen unterzogen. Ich war schüchtern, hatte Hemmungen im Umgang mit anderen Menschen, wußte mich nicht auszudrücken und nicht zu bewegen. Hinzu kam, daß ich nach wie vor in schäbiger und abgetragener, auch zu klein gewordener Kleidung herumlief. Mein Eindruck auf andere, insbesondere in einer solchen Ausnahmesituation, muß wohl entsprechend negativ gewesen sein.
Der Tag der Prüfung war gekommen. Ich wanderte die Dorfstraße entlang von Endsee bis Steinach-Bahnhof, das war ein Weg von ca. 5 km, den ich in den kommenden zwei Jahren täglich zweimal zu Fuß zurücklegen sollte. Zitternd erstand ich am Schalter die erforderliche Fahrkarte. Dann bestieg ich total verunsichert das Zugabteil und drückte mich klopfenden Herzens in eine Ecke. Am Bahnhof Ansbach angekommen, mußte ich mich erst durchfragen, um zur Handelsschule zu gelangen. Das gleiche Problem ergab sich innerhalb des Schulgebäudes.
Nachdem ich den Prüfungsraum betreten hatte, stellte ich fest, daß sich die meisten Mädchen bereits aus gemeinsamen Klassen kannten. Die gegenseitigen Begrüßungen und die ungezwungenen lauten Unterhaltungen ließen mich noch unsicherer werden und nahmen mir den ganzen Mut. Ich war in einer Verfassung, in der ich am liebsten den Raum wieder verlassen und nach Hause zurückgekehrt wäre. Doch das durfte ich meinen Eltern, die mir diese Chance eingeräumt hatten, nicht antun. Sie hatten keine Vorstellung von der Zusammensetzung der Prüflinge. Sie waren sich nicht darüber im klaren, daß ich eine der wenigen sein würde, die aus einer Dorfschule mit geringerer Allgemeinbildung mit Oberschülerinnen und Gymnasiastinnen konkurrieren mußte. Ich war dem Weinen näher als dem Lachen.
Wir hatten alle in den Bänken Platz genommen. Die Prüfungsbogen waren verteilt: Allgemeinwissen, Rechnen, Erdkunde, Geschichte und Deutsch gehörten zu den Prüfungsfächern. Schon beim Rechnen flossen bei mir die ersten Tränen. Neben verschiedenen Rechenaufgaben waren auch Bruchrechnungen gefragt. Gerade das Bruchrechnen hatte ich nie gelernt, denn dieser Stoff war in der Klasse behandelt worden, die ich seinerzeit überspringen durfte, um altersmäßig wieder entsprechend eingestuft werden zu können. Ich widmete mich den anderen Aufgaben und ließ das Bruchrechnen unberücksichtigt. Bei den Fächern Erdkunde und Geschichte stellten sich gewisse Schwierigkeiten ein. Den geforderten Aufsatz dagegen schrieb ich fließend und mit einem guten Gefühl nieder. Das Deutschdiktat meisterte ich - wie sich später herausstellte - ohne orthographische und ohne Interpunktionsfehler. Bei der anschließenden mündlichen Prüfung geriet ich ins Stottern, was aber nicht unbedingt auf Unwissen, sondern mehr auf Schüchternheit und meine Hemmungen zurückzuführen war. Hier war ich nun überzeugt, total versagt zu haben.
Meine Gefühle nach Abschluß dieser Prüfung waren sehr zwiespältig. Einesteils hatte ich Fragen richtig beantwortet, andererseits wußte ich aber auch, Lücken hinterlassen zu haben. Die Angst, durchzufallen, saß mir wie ein Gespenst im Nacken und verfolgte mich auch während der Heimfahrt von Ansbach nach Steinach. Zu Hause angekommen, weinte ich mich erst einmal aus, was bei meinen Eltern Bestürzung hervorrief. Offensichtlich konnten sie sich nicht in meinen Seelenzustand versetzen. Das, was mich bewegte, war zum einen die Angst, nicht bestanden zu haben. Ehrgeizig wie ich war, wäre das für mich neben der Schande noch ein großer Schmerz gewesen. Zum anderen wollte ich meine Eltern nicht enttäuschen. Durch den Besuch der Handelsschule sahen sie die einzige Chance, mich in eine einigermaßen gute berufliche Bahn lenken zu können, auch wenn es bei weitem nicht ihren und meinen eigenen Zukunftsvorstellungen entsprach. Und dann waren da noch die Dorfbewohner, meine Mitschüler der Dorfschule und mein Lehrer. Wie würden sie wohl über mich denken, wäre ich an dieser Prüfung gescheitert. - Es folgten bange drei Wochen des Wartens. Dann brachte die Post endlich den ersehnten Brief. Ich war aufgenommen.
Schulzeit in Ansbach
Durch die tägliche Fahrt zur Handelsschule nach Ansbach reduzierte sich die mir zur Verfügung stehende Zeit ganz gewaltig. Morgens kurz nach 5.00 Uhr verließ ich das Haus und marschierte zum 5 km entfernten Bahnhof Steinach. Kurz nach 6.00 Uhr brachte mich der Zug nach Ansbach. Während der Bahnfahrt hatte ich Gelegenheit, mich noch einmal mit dem Lehrstoff bzw. mit meinen Hausaufgaben zu beschäftigen. Da ich vor dem offiziellen Unterrichtsbeginn bereits im Schulhaus war, konnte ich einzelne Aufgaben noch mit Mitschülerinnen besprechen. Die insgesamt sehr kurze Schulzeit bzw. die fehlenden Unterrichtsjahre machten sich jetzt doch bemerkbar. Ich mußte mich sehr anstrengen, um den Stoff zu bewältigen. Hinzu kam, daß meine Mitschülerinnen, die aus höheren Schulen übergewechselt waren, bereits über umfangreiche Englischkenntnisse verfügten, die mir fehlten. Ich hatte daher sehr viel nachzuholen.
Die dürftige und mangelhafte Ernährung, die täglichen kilometerweiten Fußmärsche und die geistige Anstrengung wirkten sich auf meine körperliche Verfassung aus. Ich war dünn und anfällig für jede kleinste Erkältung. Was mein äußeres Erscheinungsbild betraf, hatte sich kaum etwas geändert. Nach wie vor trug ich die gleichen, mittlerweile zu klein gewordenen Kleidungsstücke. An den Wochenenden wurden die Sachen gewaschen, am Montag erschien ich wieder im gleichen Röckchen in meiner Schulbank. Während meine Mitschülerinnen bereits mit Make up, schicken Frisuren und modischem Accessoire kokettierten, präsentierte ich mich immer noch ärmlich. Auch ich hätte gerne einen neuen Pullover, ein Paar Seidenstrümpfe - ich trug immer noch gestrickte Wollstrümpfe - oder sogar einmal einen Ring vorgezeigt. Ein derartiger Luxus war mir aber nicht vergönnt. Natürlich war ich mir bewußt, Vertriebene zu sein und von meinen Eltern nicht verlangen zu können, daß sie mir irgendwelchen jugendlichen Schnickschnack finanzierten, nachdem wichtige Anschaffungen vorrangig waren, aber ich litt unter dieser Armut. Sogar auf Wurst- und Käsebrötchen, wie sie andere in der Pause auspackten, hatte ich zu verzichten. Mein Schulfrühstück bestand aus Margarinebrot, manchmal ergänzt durch einen Apfel oder eine Birne.
An gemeinsamen Kinobesuchen oder sonstigen Klassenausflügen konnte ich nicht teilnehmen. Mein Vater verdiente so wenig, daß meine Eltern Mühe hatten, für mich das Schulgeld und die Mittel für Bücher und Hefte aufzubringen. Hinzu kamen die Fahrtkosten der Bahn. Dem größten Verschleiß unterlagen meine Schuhsohlen. Schließlich legte ich jeden Tag allein für den Weg zum und vom Bahnhof etliche Kilometer zurück, nicht mitgerechnet alle anderen täglich anfallenden Strecken. Mittlerweile besaß ich neben meinen hohen Schnürschuhen bereits ein zweites Paar Schuhe, aber mein Wachstum war noch nicht abgeschlossen. Die Schuhe drückten, die Zehenspitzen hatten sich blau gefärbt und schmerzten. Es blieb meinen Eltern nichts übrig, als noch einmal in die Tasche zu greifen.
Wohnungsmäßig hatten wir uns in der Zwischenzeit etwas verbessert. In einem Häuschen in der Mitte des Dorfes war die Erdgeschoßwohnung, bestehend aus zwei kleinen Zimmerchen und einer Kochgelegenheit, freigeworden. Das Plumpsklosett befand sich diesmal innerhalb des Gebäudes. Meinen Eltern stand nun zusammen mit meinem kleinen Bruder ein Schlafzimmer zur Verfügung. Dieses „Schlafzimmer“ war so klein, daß nur die beiden Betten darin Platz fanden, weitere Möbelstücke paßten nicht mehr hinein. Ich schlief nach wie vor auf meinem Feldbett im gemeinsamen Aufenthaltsraum. Das bedeutete allerdings, daß ich erst schlafen gehen konnte, wenn die anderen den Wohnraum freigemacht hatten bzw. ich am Morgen meinen Schlafplatz wieder räumen mußte, sobald die Familie das Zimmer benötigte. Nun, ich verließ das Haus ohnehin schon morgens kurz nach 5.00 Uhr, so daß Mutter mein Bettzeug wegräumen und so wieder Platz schaffen konnte.
Während der Schulzeit stiegen meine Ansprüche doch ein wenig, denn ich konnte Vergleiche anstellen. Ich schämte mich nicht nur wegen meines ärmlichen Aussehens, sondern auch deshalb, daß ich mich von allen gemeinsamen Unternehmungen ausschließen mußte. Ich hatte kein Geld, um mir Schokolade oder Eis zu kaufen, ich konnte meine Mitschülerinnen nicht in ein Café begleiten. Wenn über Kinofilme oder sonstige Veranstaltungen diskutiert wurde, zog ich mich zurück. Für dieses Zurückziehen gab es jedoch noch einen anderen Grund. Während unseres Aufenthaltes in dem kleinen fränkischen Dorf hatte ich keinerlei Gelegenheit, irgendwelche gesellschaftlichen Umgangsformen zu lernen. Ich wußte nicht, wie ich mich Fremden gegenüber zu verhalten hatte. Ich hatte Hemmungen, irgendeine Behörde zu betreten oder eine Auskunft zu erfragen. Wurde ich von höherstehenden Personen angesprochen, brach mir der Schweiß aus allen Poren, ich wurde rot, meine Hände zitterten, die Kehle war mir wie zugeschnürt. Daß ein derartiges Verhalten auf andere nicht gerade den besten Eindruck machte, versteht sich von selbst. Ich litt unter Komplexen, die sich später, als ich ins Arbeitsleben eintreten sollte, noch verstärkten. Lagerleben, ständige Zurückweisungen und Unterdrückung wirkten sich negativ auf mein Selbstvertrauen aus, ja, ich hatte überhaupt keines. Wer waren wir denn schon? Vertriebene, oder, wie man uns auch bezeichnete, „Zugereiste“.
Irgend etwas mußte ich ändern, zumindest an meinem Äußeren, wollte ich nicht ganz zur Außenseiterin werden. Den Ausschlag für meinen Entschluß gaben Sommerschühchen aus Plastik und bunte Socken, die einige meiner Mitschülerinnen eines schönen Sommermorgens an den Füßen trugen. Es hieß, daß man im amerikanischen Viertel solche Kunststoffschuhe billig kaufen könne. Die Sohlen seien wesentlich haltbarer als die der herkömmlichen Schläppchen. Diese in weiß, rot und grün zu wählenden Schuhe mit den entsprechenden bunten Söckchen ließen mein Herz höherschlagen. Ich wollte sie haben, ich mußte sie haben. Einmal wollte ich mit den anderen gleichziehen. Als ich, wie jeden Tag, am Spätnachmittag zu Hause ankam, schwärmte ich meiner Mutter von diesen bunten Plastikschuhen vor, und wie nötig ich sie doch hätte, zumal sie angeblich wesentlich haltbarer seien als andere. Meine Mutter hörte sich meine begeisterte Schilderung an, sagte aber, daß sie mich enttäuschen müsse, denn sie habe dafür kein Geld. Es sei schon schwer genug, das Schulmaterial zu bezahlen.
Weinend verließ ich das Haus, doch bereits mit einem vorgefaßten Plan. Mir war bekannt, daß in einem außerhalb des Ortes befindlichen Gipsbruch immer wieder Hilfskräfte, auch weibliche, eingestellt wurden, die für einen Stundenlohn von DM 1,00 dort Vorbereitungsarbeiten für Sprengungen verrichteten. In einer derartigen Tätigkeit sah ich meine Chance, endlich etwas zu verdienen und meine Eltern zu entlasten, auch wenn meine Freizeit dadurch noch verkürzt wurde. Es blieben mir ohnehin nur wenige Stunden für eigene Belange. Von morgens um 5.00 Uhr bis zum Spätnachmittag war ich außer Haus. Anschließend hatte ich Schulaufgaben zu machen und zu lernen, und letztendlich half ich meiner Mutter auch noch bei der Wäsche und im Haushalt, denn über Küchen- oder Haushaltsmaschinen verfügten damals noch die wenigsten. Ich hatte mir jedenfalls vorgenommen, künftig meine Schule zum Teil selbst zu finanzieren und von dem verbleibenden Geld persönliche Bedürfnisse zu befriedigen.
Meinen Plan, im Gipsbruch zu arbeiten, setzte ich sehr bald in die Tat um. Es war Sommer und an den Abenden blieb es lange hell. Woher ich den Mut nahm, in eigener Verantwortung und ohne fremde Hilfe an einem Arbeitsplatz vorstellig zu werden, ist mir heute noch ein Rätsel, denn ich war damals voller Hemmungen. Es muß wohl der starke Wunsch, eigenes Geld zu verdienen, gewesen sein, und nicht zuletzt die Vorstellung, Plastikschühchen und bunte Socken zu besitzen, die mich zu diesem Schritt bewogen haben. Jedenfalls machte ich mich auf den Weg, um nach den Bedingungen zu fragen, und kehrte mit der Zusage, ich könne am nächsten Spätnachmittag anfangen, zu meinen Eltern zurück. Die Begeisterung meiner Mutter hielt sich zunächst in Grenzen, aber dann war sie doch einverstanden, denn ohne zusätzliches Einkommen hätte ich meine persönlichen Wünsche nicht erfüllen können.
Um zu dem Gipsbruch zu gelangen, mußte man ein Wald- und ein Feldstück überqueren. Weite Märsche war ich durch den täglichen Schulweg gewöhnt. Nun kamen eben noch ein paar Kilometer dazu. Und für den Rückweg nach Einbruch der Dunkelheit hatte ich die Dynamotaschenlampe meines Vaters dabei. Angst kannte ich nicht, und während der damaligen Zeit wäre sie auch unbegründet gewesen. Es gab - trotz Armut und Hunger - keine Überfälle, keine Einbrüche.
Meine Arbeit im Gipsbruch bestand darin, aus kompakten, steifen, großen, zum Teil schon benutzten und zerknautschten Papiersäcken entsprechend große Stücke zu schneiden, zu glätten und sie zu einem Rohr zusammenzurollen. Diese Arbeit war zwar mit ständigem Bücken und Knien verbunden, denn sie wurde auf der Erde verrichtet, aber sie war nicht schwer. Weitaus mühsamer erwies sich das Füllen dieser Röhren. Es gehörte zu meinen Aufgaben, in die Grube hinabzusteigen, in der sich der heiße gemahlene Gipssand bzw. -staub befand, diesen in Eimer oder Fässer zu schaufeln und mit dieser Last die Leiter wieder hochzuklettern. Dieses Gemisch füllte ich - per Hand - in die schmale Öffnung der von mir hergestellten „Patronen“. War der Gipsstaub zu fein, knickten meine vorgefertigten Hüllen ein und konnten als Stopfmaterial für die Sprenglöcher nicht verwendet werden. War der Sand zu grob, rutschte die Füllung zu schnell nach unten und es mußte vor dem Verschließen der Papierhüllen immer wieder nachgefüllt werden oder die Hüllen platzten auf.
Innerhalb kurzer Zeit waren meine Hände rauh und rissig, der Gipsstaub legte sich nicht nur auf Haut und Haare sondern setzte sich auch in den Bronchien fest. Ich hüstelte ununterbrochen. Mein Rücken schmerzte vom Bücken, noch mehr aber vom Schleppen dieser schweren Behälter, gefüllt mit heißem Gips, an dem ich mir häufig die Finger verbrannte. Zu diesem Zeitpunkt war ich 15 Jahre alt. Was ich seinerzeit aus Unwissenheit meinem Rücken zumutete, machte sich erst später bemerkbar. Zu viel hatte mein Knochengerüst schon im Kindesalter aushalten müssen. Bandscheibenvorfälle, eine verkrümmte Wirbelsäule und ständige Rückenschmerzen im Erwachsenenalter, sind die Folge.
Aber ich verdiente Geld. Fast täglich arbeitete ich mehrere Stunden neben und in der Gipsgrube. An manchen Tagen befand ich mich abends ganz allein im Werk. Ich kannte meine Aufgabe, verrichtete sie zügig und stapelte die von mir angefertigten Hülsen. Je höher die Anzahl, desto stolzer war ich auf meine Arbeit, auch wenn ich sie nicht stück- sondern stundenweise bezahlt erhielt. Einmal wöchentlich war Zahltag. Und innerhalb kurzer Zeit konnte ich mir gelbe Plastikschuhe und bunte Söckchen kaufen.
Als einzige in der Klasse trug ich noch Zöpfe. Neidisch schaute ich auf die dauergewellten Köpfe meiner Mitschülerinnen. Ich wollte endlich die Zöpfe loswerden und ebenfalls eine Kurzfrisur tragen. Dazu war aber die Einwilligung der Eltern erforderlich. Also sprach ich bei nächstbester Gelegenheit mit meiner Mutter:
„Mutti, mit den Zöpfen sehe ich doch wirklich altmodisch aus. Niemand in der Klasse außer mir hat in diesem Alter noch Zöpfe. Ich möchte sie abschneiden lassen“. -
„So, die Zöppe willste obschneidn lossen. Die kennste doch noch a bißle behalten. Des Geld firs Obschneidn kennt ich schon zusommenkriegen, oba dann mußde doch imma wieda zum Frisär, wer soll dos denn bezohln“, fragte meine Mutter, die ihren Jägerndorfer Dialekt nie abgelegt hat im Gegensatz zu meinem Vater, der immer hochdeutsch sprach.
Nun, indirekt hatte sie damit ihr Einverständnis zum Abschneiden der Zöpfe bekundet. Das Geld dazu würde sie mir auch geben. Und was die künftigen Friseurbesuche anbelangt, so wollte ich dafür selbst aufkommen. Schließlich verdiente ich ja Geld im Gipsbruch.
So nahm ich eines Tages meinen Mut zusammen, suchte zum erstenmal in meinem Leben einen Friseur auf und ließ meine Zöpfe dort zurück. Stolz erschien ich am nächsten Morgen in der Klasse. Ich hatte kurzes dauergewelltes Haar und fühlte mich unheimlich erwachsen und weltstädtisch.
Mein Vater, der bereits in Jägerndorf bei der Post beschäftigt gewesen war, hatte alle Anstrengungen unternommen, auch hier wieder als Beamter in den technischen Dienst übernommen zu werden. Zwar war ihm das nicht in Rothenburg nahe Endsee, dafür aber in Nürnberg gelungen. Es sollte aufwärts gehen. Doch bis zu einem einigermaßen geregelten Familienleben war es noch ein weiter Weg.
Zu groß waren die Entbehrungen während der letzten Jahre gewesen, zu groß auch der Nachholbedarf in allen Dingen des täglichen Lebens. Das begann bei der Kleidung und hörte bei Küchengeräten und Einrichtungsgegenständen auf. Es mag in heutiger Zeit unglaublich klingen, aber wir besaßen wirklich nur das Nötigste. Wir hatten weder Federbetten noch Wäsche, es fehlten Töpfe und Teller. Unser einziger Luxus bestand aus einem alten Rundfunkempfänger, den sich mein Vater als Tüftler und Fachmann zusammengebastelt hatte.
Ebenso wie ich seinerzeit meinem ersten Schultag in Ansbach entgegengebangt hatte, so erging es nun meinem Vater, als er vom Nürnberger Postamt, der Fernmeldestelle, die Zusage erhielt, den Dienst dort antreten zu können und wieder als Beamter übernommen zu werden.
Da Vaters Geld nicht einmal für ein möbliertes Zimmer in Nürnberg ausreichte, logierte er zusammen mit anderen Kollegen in einem gemeinsamen Zimmer der Postunterkunft. Preiswertes Kantinenessen sowie das billige Massenquartier halfen ihm finanziell über die erste Zeit hinweg. Eine Familienheimfahrt konnte er sich nur alle paar Wochen leisten, denn er sparte für die Einrichtung einer Wohnung. Schließlich wollten wir ja irgendwann einmal wieder zusammen, und menschenwürdig, leben.
Nachdem ich immer noch die Handelsschule in Ansbach besuchte, bestand auch keine Dringlichkeit eines Umzugs nach Nürnberg. Wir konnten also ruhig weiter in Endsee wohnen bleiben. In der Zwischenzeit hatte sich in unserer Familie, trotz aller widrigen Umstände, noch einmal Nachwuchs eingestellt. Ich hatte einen zweiten kleinen Bruder bekommen.
Die Monate vergingen mit Schule, Lernen und Arbeit im Gipsbruch. Mein ehemals kleiner, aber jetzt mittlerer Bruder, besuchte wie ich die Steinacher Dorfschule. Im Gegensatz zu mir hatte er als später geborener mehr Chancen, es beruflich zu etwas zu bringen. Auch der jüngste Bruder wuchs in eine Zeit hinein, in der es mit uns und allgemein wirtschaftlich aufwärts ging.
Ich stand kurz vor der Abschlußprüfung, die anschließend durch einen Schulball gekrönt werden sollte. Meine Mitschülerinnen, von denen die meisten bereits einen Freund hatten, bereiteten sich auf dieses Fest vor. Es sollte ein Ballabend mit langem Kleid werden. Ich besaß weder einen Freund noch verfügte ich über ein langes Kleid, doch am Ball im Ansbacher Drechselsgarten, seinerzeit ein einfacher Gasthof mit Tanzsaal, wollte auch ich teilnehmen. Während die anderen Mädchen sich um ihre Frisuren und um den anzulegenden Schmuck sorgten, galt meine Sorge einem Kleid. Es war mir zwar nicht angenehm, meinen Mitschülerinnen eröffnen zu müssen, daß meine Eltern finanziell nicht in der Lage sind, mir ein Kleid zu kaufen, aber ich überwand mich dennoch. Andererseits sah ich ein, daß eine solche Ausgabe in den Augen meiner Familie, die andere Dinge nötiger hatte, ein wirklich überflüssiges Bekleidungsstück ist, welches ich möglicherweise nur ein einziges Mal im Leben anzog. Auf dem Dorf gab es keine Festivitäten, die lange Garderobe erforderten. Ich besaß allerdings auch kein kurzes Kleid, welches für einen Ball geeignet gewesen wäre. In meiner üblichen Schulkleidung hätte ich zum Tanz kommen müssen. Wochenlang beschäftigte mich der Gedanke an Ball, Kleid und Tänzer. Meine Mitschülerinnen zeigten Verständnis für meine Sorgen und unsere Situation. Nachdem mir eine Schulfreundin zugesagt hatte, mir einen Tänzer zu besorgen, versprach mir eine andere, mir mit einem Kleid auszuhelfen. So geschah es auch. Einige Tage vor dem Ball sollte ich das Kleid zunächst einmal anprobieren. Es saß einigermaßen, aber meine Unterwäsche war hierfür nicht komplett. Sogar in diesen Dingen war ich rückständig. Zu meiner Unterbekleidung fehlte noch ein Büstenhalter, ich hatte einfach keinen. Und genau auf dieses Bekleidungsstück kam es bei diesem Ballkleid an. Ich trug Mutter meinen Wunsch nach einem Büstenhalter vor, ja, ich versuchte sie zu überzeugen, daß für einen perfekten Sitz des Kleides dieser Büstenhalter unbedingt erforderlich sei, stieß aber bei ihr auf Unverständnis.
„Zu wos brauchst Du denn an Bistenhalter“, fragte sie mich. „So wos brauchst Du nie, des is unnetig“.
Wieder einmal war ich Außenseiterin. Eine andere Schulfreundin half schließlich auch noch mit einem Büstenhalter aus, so daß ich mit geliehenem Tänzer, geliehenem Kleid und geliehenem Büstenhalter den Abschlußball besuchen konnte. Ich war 16 Jahre alt, die Armut hatte angehalten.
Die Familie ist vereint - Nürnberg
Die Schulzeit lag hinter mir. Der Ernst des Lebens hatte begonnen, aber damit einhergehend auch die ersten Probleme. Im Dorf selbst gab es keine meiner Ausbildung entsprechenden Arbeitsplätze. Auch in den umliegenden Ortschaften bestand keine Möglichkeit, mich in einem Büro unterzubringen. Wir wohnten in einem völlig ländlich geprägten Gebiet, ohne Industrie, ohne Handelsunternehmen. Der ganze Kreis bestand aus landwirtschaftlichen Gehöften. In den Dorfgemeinden gab es weder eine Arzt- noch eine Rechtsanwaltspraxis, keine Postämter, auch nicht die kleinsten Verwaltungsstellen. Die Bürgermeister der einzelnen Gemeinden erledigten ihre Obliegenheiten so nebenbei in der guten Stube. Ihre Aufgabe bestand u.a. darin, hin und wieder ein Formular zu erstellen oder eine Urkunde zu beglaubigen. Derartige Angelegenheiten wurden abends nach der Feld- und Stallarbeit in privater Runde erledigt. Schreibkräfte waren hierfür nicht erforderlich. Für mich bestand also keinerlei Aussicht, im Dorf oder der Umgebung eine Arbeitsstelle zu finden. In Anbetracht eines in naher oder fernerer Zukunft durchzuführenden Umzugs der gesamten Familie nach Nürnberg hielten es meine Eltern daher für angebracht, daß ich mich dort um eine Stelle bewerbe.
Die Eltern gingen davon aus, daß ich mit einem guten Abschlußzeugnis der Handelsschule, welches der mittleren Reife gleichzusetzen ist, durchaus in jedem Büro als „Kontoristin“, so war die damalige Berufsbezeichnung, tätig sein könne. Sie ließen aber außer acht, daß ich weder über das notwendige Allgemeinwissen, noch über Umgangsformen, und schon gar nicht über eine entsprechende Kleidung, Zubehör oder Fähigkeiten verfügte, um mich selbst entsprechend präsentieren zu können. Ich war schüchtern, voller Hemmungen, unfähig, mich im Straßenverkehr einer Großstadt zu bewegen und es fehlte mir die entsprechende Wortgewandtheit, die erforderlich ist, um ein Bewerbungsgespräch zu führen.
Nach einem Wochenendbesuch in Endsee nahm mich mein Vater an einem Sonntagabend mit nach Nürnberg. Wohl hatte er schon Wochen vorher nach einem möblierten Zimmer für mich Ausschau gehalten, aber die dafür geforderten Preise sprengten seinen finanziellen Rahmen. Er konnte mir kein Zimmer bezahlen. Also bat er seine Arbeitskollegen in der Männerunterkunft, mich für einige Nächte mitbringen zu dürfen und der Verwaltung gegenüber Stillschweigen zu bewahren. Den Schlafraum teilten sich etwa sechs Männer unterschiedlichen Alters. Es gab keinerlei Trennwände zwischen den Betten. Zu jeder Schlafstelle gehörte ein Kleiderspind, ein Nachtkästchen und ein Stuhl. In der Mitte des Raumes befand sich ein größerer Tisch, an dem abends gegessen, gelesen oder Karten gespielt wurde. Außerdem war dieser Gemeinschaftsraum nur mit einem Waschbecken, nicht aber mit einem separaten Bad ausgestattet. Ich hatte also kaum die Möglichkeit, mich richtig zu waschen. Abends schmuggelte mich mein Vater hinein, morgens wieder hinaus. Er selbst, aber auch seine Kollegen, setzten durch einen solchen Verstoß der Hausordnung den Arbeitsplatz aufs Spiel. Die Kollegen hielten dicht. Zusammen mit meinem Vater mußte ich, die 16jährige, in einem Bett schlafen. Ich fühlte mich in dieser Männergesellschaft total deplaciert, auch wenn ich mich dort nur zur Schlafenszeit aufhielt. Obwohl es sich um einen unhaltbaren Zustand handelte, blieb uns nur diese eine Möglichkeit.
Da ich noch nie zuvor in Nürnberg gewesen war, benötigte ich für die Tage meiner Stellensuche die Hilfe meines Vaters. Er suchte die Zeitungen nach Stellenangeboten durch und vereinbarte telefonisch die Vorstellungstermine. Nur zwei Tage Urlaub waren ihm bewilligt worden. Während dieser kurzen Zeit mußte ich einen Arbeitsplatz gefunden haben. Zusammen suchten wir die Sitze der ausgeschriebenen Stellen. Trotz Einsichtnahme in den Stadtplan fanden wir unser Ziel nicht unmittelbar. Oft mußten weite Wegstrecken zurückgelegt werden. Auffällige Hinweise und großzügige Reklameschilder waren damals noch nicht üblich.
Es war Herbst. Ich trug einen gräßlichen grasgrünen Mantel, den wir billig bei den Amerikanern gekauft hatten. Meine dünnen Beine steckten in gestrickten Wollstrümpfen. Die abgetragenen Schnürschuhe paßten weder zur Farbe der Strümpfe noch zu der des Mantels. Die Haare hatte ich schon seit Tagen nicht mehr waschen können, sie klebten ungepflegt und fett an meinem Kopf. Eine Handtasche besaß ich nicht. Mutter hatte mir eine alte Einkaufstasche mitgegeben, in der ich meine Zeugnisse herumtrug. In diesem Aufzug präsentierte ich mich bei verschiedenen Arbeitgebern, und brachte sogar den Mut auf, mich im Nürnberger Carlton Hotel vorzustellen, welches zu jenem Zeitpunkt eine Kontoristin suchte. Ich erinnere mich, daß das Vorstellungsgespräch in diesem Hause erst gar nicht zustande kam. Man fixierte mich, hörte sich mein stotterndes Begehren an und schickte mich sofort wieder weg. Ich sei für diese Stelle ungeeignet, wurde mir gesagt.
Wenn ich heute versuche, mich in die damalige Situation zurückzuversetzen, dann kann ich die Reaktion der Personalstelle durchaus nachvollziehen. In meinem damaligen Aufzug hätte man mich - auf den ersten Blick - für eine Stadtstreicherin halten können, deren stotterndes Anliegen nicht für voll genommen werden muß.
Derartige Erfahrungen machte ich während dieser beiden Tage noch oft. Mein Vater war ebenso niedergeschlagen wie ich. Er hatte sich die Stellensuche offensichtlich einfacher vorgestellt. Nicht die Noten in meinen Zeugnissen waren für die Ablehnungen ausschlaggebend, sondern meine unmögliche Aufmachung und mein unbeholfenes Auftreten. Mir fehlte die Gewandtheit des Stadtkindes, mir fehlte die Selbstsicherheit. Was hätte mich auch selbstsicher machen sollen? Schon ein Blick in die widerspiegelnden Schaufensterscheiben während des Vorbeigehens ließ mich vor meinem eigenen Anblick erschrecken. Und wenn ich die Passanten um mich herum betrachtete, war mir schon bewußt, daß ich in dieses Umfeld nicht passe. Meinen Vater müssen ähnliche Gedanken gequält haben. Zum einen sah er in mir seine Tochter, vielleicht immer noch das Kind, wodurch das äußere Erscheinungsbild verdrängt wurde. Zum anderen war auch er nüchtern und realitätsbezogen genug, um erkennen zu können, daß meine Chancen nicht zum besten standen. Doch die Zeit und die Umstände drängten. Wir mußten unsere Bemühungen um einen Arbeitsplatz fortsetzen.
Der erste Tag der Stellensuche blieb erfolglos. Der nächste Morgen brachte kein anderes Ergebnis. Mittlerweile waren meine Augen vom Weinen gerötet, denn diese Mißerfolge zehrten an meiner Seele, und dies um so mehr, als ich wußte, daß Vater nur diese beiden Tage für mich freigenommen hatte. Ab morgen müßte ich Straßen und Adressen alleine suchen. Der Zeitaufwand dafür wäre wesentlich größer gewesen. Ich verfügte auch nicht über genügend Geld, um sämtliche Strecken mit öffentlichen Verkehrsmitteln abfahren zu können. Ganz abgesehen davon, war ich vorher noch nie allein mit einer Straßenbahn gefahren. Das Verkehrsnetz mit all den Umsteigestellen war für mich etwas Unbekanntes. Hinzu kam der Gedanke, am Abend wiederum in diese Männerunterkunft eingeschmuggelt zu werden. Ich befand mich in einem Zustand, den man nicht beschreiben und den ein Außenstehender nicht nachempfinden kann. Einem in der heutigen modernen Zeit aufgewachsenen Menschen mögen diese mir damals fast unüberwindlich erscheinenden Schwierigkeiten unverständlich sein. Für mich jedenfalls war jene Situation so gravierend, daß sich mein seelischer Zustand auch körperlich bemerkbar machte. Ich war am Ende meiner physischen und psychischen Kraft angelangt und schleppte mich nur noch von Stelle zu Stelle. Heute werden Stellenbewerber nach einem Vorstellungsgespräch mit der Zusage einer schriftlichen Nachricht verabschiedet, so daß immer noch ein wenig Hoffnung bleibt. Ich erhielt die Antworten unmittelbar in Form der mündlich ausgesprochenen Ablehnung. Was hätte mich nach all diesen negativen Erfahrungen aufrichten, was mir Auftrieb geben sollen?
Am Spätnachmittag des zweiten Tages bekam ich eine Zusage. Ein renommiertes Nürnberger Bettengeschäft suchte für das Büro eine Kontoristin. Offensichtlich störte mein Aussehen dort nicht allzusehr, dafür lag das angebotene Gehalt weit unter dem anderer Anfangskontoristinnen, wie sich später herausstellte. Einen Tag später, am 1. Oktober 1951, nahm ich meine Arbeit auf.
In der Ecke eines kleinen Hinterzimmers, welches als Büro diente, bekam ich meinen Platz zugewiesen. Genau gesagt, stand mir etwa ein Viertel der Arbeitsfläche des vom Buchhalter der Firma besetzten Schreibtisches zur Verfügung. Als Sitzgelegenheit hatte man noch ein Hockerchen zwischen Wand und Schreibtisch gequetscht. In dieser unbequemen Haltung durfte ich eine uralte schwere Adler-Schreibmaschine bedienen. Unbeholfen im Umgang mit Menschen, insbesondere mit Kunden, machte ich meinem Arbeitgeber keine große Freude. Nicht die Diktataufnahme- oder -wiedergabe, nicht das Formulieren kleiner Briefe oder das Ausfüllen von Rechnungs- oder Überweisungsformularen be-reitete mir Schwierigkeiten, sondern die Mithilfe im Verkaufsgeschäft und das Handhaben eines Telefons. Der Firmeninhaber hatte die Vorstellung, ich könne sowohl im Büro als auch im Verkauf tätig werden. Für den Verkauf fehlte mir das Fachwissen, vor allem aber die Aufgeschlossenheit und das Verhandlungsgeschick Kunden gegenüber. Und als man mich zum ersten Mal aufforderte, am Telefon zu antworten, brachte ich keinen einzigen Ton heraus. Im ersten Moment wußte ich nicht einmal, welches die Sprechmuschel und welches der Hörer ist. Noch nie zuvor hatte ich ein Telefon in der Hand gehabt, geschweige denn hineingesprochen. Zur damaligen Zeit besaß kaum jemand einen Fernsprecher, schon gar nicht auf dem Dorf. Ich mußte viele Rügen und Ermahnungen über mich ergehen lassen. Man konnte sich meine Rückständigkeit einfach nicht erklären. Wie sollte ich dem Arbeitgeber klarmachen, auf welche Weise meine letzten Kindheits- und Jugendjahre verlaufen waren, was ich alles mitgemacht und durchlebt, wie sehr ich nicht nur unter Hunger, sondern auch darunter gelitten hatte, daß ich mich in jeder Beziehung einschränken mußte, daß ich nicht das Leben eines normalen jungen Mädchens führen konnte. Ich war doch immer im Abseits gestanden.
In der Zwischenzeit war mein Vater aktiv geworden. Er hatte alle Möglichkeiten ausgeschöpft, um für mich eine Bleibe aufzutreiben und war im Norden von Nürnberg an eine alte Dame geraten, die zwecks Aufbesserung ihrer schmalen Rente ein Zimmerchen ihrer Zweizimmerwohnung vermietete. Die Wohnung verfügte zwar über kein Bad, dafür gab es aber ein Spülbecken in der Küche, welches ich zur Körperreinigung und zum Wäschewaschen benutzen durfte. Die Toilette befand sich im Treppenhaus. Es war meinem Vater gelungen, mit der alten Dame dahingehend einig zu werden, daß ich im ersten Monat meines Dortseins die Miete im nachhinein bezahlen würde. Später sollten die Zahlungen dann jeweils am 1. des Monats im voraus erfolgen. Nun hatte ich endlich ein Zimmer und ein Bett für mich allein. Die Dame war verhältnismäßig zurückhaltend, aber nicht unfreundlich. Wir kamen während der Monate, in denen ich dort wohnte, recht gut miteinander aus. Mittlerweile hatte ich auch in Erfahrung gebracht, wo sich das öffentliche Wannenbad befindet. Zwar schmälerten die Ausgaben dafür wieder meinen Geldbeutel, aber die Sitzungen im warmen Bad waren für mich neben der profanen Reinigungsprozedur ein wahrer Genuß.
Die ersten vier Wochen meines Berufslebens waren sehr schwer für mich insofern, als mir eine minimale Geldsumme zur Verfügung stand. Nur einige wenige Mark hatte ich von meinen Eltern erhalten. Damit mußte ich zurechtkommen. Der Monat erschien mir unendlich lang. Den Weg zur täglichen Arbeit legte ich natürlich zu Fuß zurück, es waren etliche Kilometer. Für meinen täglichen Nahrungsbedarf blieben mir - errechnet für den ganzen Monat - nur Pfennige. Außer Brot, Margarine und manchmal einen Apfel, konnte ich mir nichts leisten. Da ich mit niemandem über meine finanziellen Sorgen sprach, konnte sich mein Arbeitgeber auch nicht erklären, warum ich des öfteren ohnmächtig wurde. Meist passierte dies dann, wenn man mich beauftragt hatte, oben auf dem Speicher Kinderwägen oder Betten zu verpacken. Die Anstrengung, das Bücken, die unzureichende Nahrungsaufnahme und nicht zuletzt die psychische Anspannung ließen mich häufig das Bewußtsein verlieren. Fast hätte ich dieserhalb auch wieder meinen Arbeitsplatz verloren, denn man vermutete hinter den häufigen Schwindelanfällen eine Krankheit. Ich war jedoch nicht krank. Mir fehlten Vitamine und Nährstoffe, mir fehlte eine anständige Ernährung. Schließlich befand ich mich immer noch in der Wachstumsphase, und die vorhergehenden Jahre der Entbehrungen waren offensichtlich auch nicht spurlos an meinem Körper vorübergegangen.
Ein anderes möbliertes Zimmer gab meinem Dasein und meinem Wohlbefinden eine glückliche Wende. Eine in der Abteilung meines Vaters bei der Post arbeitende Putzfrau suchte einen neuen Mieter für ein freigewordenes Zimmer in ihrer Wohnung. Mein Vater empfahl mich und ich zog dort ein. Diese alte Dame, eine kinderlose Witwe, behandelte mich wie eine Tochter. Abgesehen von dem gemütlichem Zimmer, in dem ich nun wohnen durfte, hatte ich auch „Familienanschluß“. Frau Sch. weckte mich morgens, bevor sie zum Dienst ging, sie brachte mir das Waschwasser, sie bereitete mir ein kleines Frühstück, sie reinigte mein Zimmer. Nach der Arbeit lud sie mich jeweils zu einem abendlichen Plausch am Kachelofen ein, und jeden Sonntag durfte ich gegen Bezahlung von einer DM 1,00 gemeinsam mit ihr zu Mittag essen. Ihr konnte ich meine Sorgen und Nöte anvertrauen, bei ihr fand ich in jeder Hinsicht Verständnis. Als Musikliebhaberin gelang es ihr, mich auch für Konzerte und Opern zu begeistern. Wann immer wir Lust und etwas erspartes Geld hatten, erfreuten wir uns der Darbietungen. Sie hatte es sich zur Aufgabe gemacht, das Theaterprogramm im Auge zu behalten und dann die billigsten Karten für die obersten Ränge zu besorgen. Sie bestand auch darauf, daß ich hin und wieder - natürlich in ihrer Begleitung - ein Tanzcafé aufsuchte, um endlich einmal das Leben zu führen, welches andere in meinem Alter schon bald hinter sich hatten. Sie war nur eine Putzfrau, aber sie besaß menschliche Wärme und Einfühlungsvermögen, wie ich es später bei einem anderen Menschen kaum wieder gefunden habe. Sie verfügte über Geist und Witz und ich habe bei ihr und durch sie viel gelernt. Nachdem ich dort ein so schönes Zuhause gefunden hatte, war mir der Umzug meiner Eltern von Endsee nach Nürnberg nicht mehr ganz so wichtig.
Von meinem ersten Arbeitgeber hatte ich mich in der Zwischenzeit getrennt und eine neue Tätigkeit in einem bakteriologisch-serologischen Institut am anderen Ende der Stadt aufgenommen. Ich war sicherer und selbstbewußter geworden. Nicht unmaßgeblichen Anteil an meiner Entwicklung hatten meine neuen Arbeitgeber, ein Bakteriologe und ein Chemiker, die mir zu erkennen gaben, daß sie mit meiner Arbeit zufrieden waren und die mich mit immer neuen Aufgaben und Herausforderungen konfrontierten. Hier wurde ich als vollwertige Kraft angesehen und als Mensch behandelt. Ich wuchs mit meinen Aufgaben. Schnell hatte ich mich in das neue Berufsgebiet eingearbeitet. Zwar mußte ich mich auch hier mit einem verhältnismäßig geringen Gehalt zufriedengeben, was aber durch eine sehr gute und zuvorkommende Behandlung und ein positives Arbeitsklima wieder kompensiert wurde. Es ging aufwärts. Endlich war ich in der Lage, mir kleinere Abwechslungen im Privatleben leisten zu können. Es begann eine Phase in meinem Leben, die ich als glücklich bezeichnen möchte.
Trotzdem gab es immer wieder Stunden, in denen mir bewußt wurde, daß ich nach wie vor zu den armen Menschen gehöre. Ich hatte kein vorzeigbares Elternhaus, in welches ich Freunde einladen konnte. Und - was mich am meisten schmerzte - keine Möglichkeit mehr, eine höhere Schule zu besuchen bzw. ein Studium zu beginnen. Mein Berufsleben war vorgezeichnet. Von den Eltern konnte ich keine Unterstützung erwarten. Ich hatte für mich selbst zu sorgen.
Als die Eltern dann von Endsee nach Nürnberg übersiedelten, gab ich schweren Herzens mein möbliertes Zimmer auf, die Familie vereinte sich. Den Kontakt mit Frau Sch. hielt ich jedoch noch über Jahre hinaus.
Eine neue Existenz wird aufgebaut
Während der darauffolgenden Jahre habe ich versucht, das Beste aus dem zu machen, was mir das Leben bereithielt.
Meine Eltern hatten in Nürnberg Fuß gefaßt, mein Vater stand als Beamter in Brot und Arbeit bei der Post. Trotzdem war dieser Anfang sehr mühsam. Zwar hatten wir eine für Postbedienstete in einer größeren Anlage erstellte Wohnung bezogen, doch es handelte sich dabei um sehr kleine und bescheidene Räumlichkeiten ohne jeglichen Komfort. Die Wohnung bestand aus drei Zimmerchen, von denen ich eines als Schlafraum mit meinem Bruder teilen mußte. Der Jüngste schlief mit im Elternzimmer. Das Wohnzimmer bot wenig Platz für uns fünf Personen. Auch in der Küche konnte man sich kaum bewegen. Das Bad war eine Fehlkonstruktion, denn es stellte sich heraus, daß kurz vor Fertigstellung des Baues noch schnell Extra-Badewannen geordert worden waren, weil eine Wanne normaler Länge keinen Platz gefunden hätte. Das gleiche traf für das Waschbecken zu. Es mußte ein Minibecken eingebaut werden, wobei es nicht mehr möglich war, eine Verbindung zum Warmwasserboiler herzustellen. Am Handwaschbecken gab es also nur kaltes Wasser. Der Wasserhahn war wegen des winzigen Beckens so unglücklich angebracht, daß man sich die Hände nicht unter dem Wasserauslauf waschen konnte, sondern dazu das Miniwaschbecken mit Wasser füllen mußte.
Da Wohnraum für Vertriebene benötigt wurde, waren diese Bauten seinerzeit in Windeseile in primitiver Bauweise und mit geringen staatlichen Mitteln hochgezogen worden. Einen Balkon gab es nicht. Schon von außen sah man den Häusern an, daß es sich hierbei um Wohnungen für Minderbemittelte handelte. Selbstverständlich waren wir froh, endlich wieder in mehreren Räumen und als Familie zusammenwohnen zu können, auch wenn wir nicht gerade stolz auf Wohnblock und Gegend waren.
Wir verfügten jetzt zwar über eine Wohnung, aber zunächst über eine leere. Für Einrichtungsgegenstände und Hausrat reichte die angesparte Summe nicht. Die Eltern waren daher gezwungen, das Nötigste zunächst auf Kredit zu kaufen. An diesem Kredit zahlten sie jahrelang. Zwar steuerte ich von meinem Einkommen, das sich seinerzeit - wir schrieben das Jahr 1953 - auf ca. DM 100,00 monatlich belief, DM 50,00 zum Familieneinkommen bei, aber dieser Betrag reichte nicht, um unser großes Defizit auszugleichen. Während andere bereits über Fernseher, Waschmaschinen, Kühlschrank, Staubsauger und Autos verfügten, plagte sich meine Mutter immer noch per Hand mit unserer Wäsche. Um keine weiteren Schulden machen zu müssen, wurde erst ein Stück nach dem anderen abbezahlt, bevor man das nächste auf Kredit kaufte. Meine Brüder benötigten wegen ihres ständigen Wachstums immer wieder neue Kleidung. Nicht alles konnte der Jüngere vom Älteren übernehmen. Meine persönlichen Bedürfnisse bestritt ich vom Rest meines eigenen Einkommens. An Urlaub oder sonstige kostenträchtige Freizeitaktivitäten war nicht zu denken.
Meine Eltern litten sehr darunter, noch einmal neu anfangen zu müssen, hatten sie doch in Jägerndorf zum Ende des Krieges bereits Neuanschaffungen getätigt und sich wohnlich eingerichtet. Mutter war mittlerweile 40 Jahre alt, der Vater 43. Manchmal kam natürlich auch der Gedanke an eine Rückkehr in die Heimat auf, zumal die Vertriebenen damals auch landsmannschaftlich enger miteinander verbunden waren. Man schmiedete - trotz unklarer politischer Verhältnisse - Pläne und versuchte, den derzeitigen Zustand als Übergangslösung zu betrachten. Im Vordergrund stand zunächst ein sicherer Arbeitsplatz, ein regelmäßiges Einkommen, ein Familienleben in einer Wohnung. Lange genug waren wir von einem Lager ins andere geschleust worden. Es war eine Zeit des Abwartens, wobei niemand so recht wußte, auf was man eigentlich wartete. Ich trat der sudetendeutschen Jugend bei und war als Jugendgruppenleiterin aktiv tätig. Auch in unseren Jugendkreisen war immer wieder von „Recht auf die Heimat“, von „Rückkehr“ die Rede, nur war uns nicht klar, auf welche Weise und wann das geschehen sollte.
Neben der täglichen Arbeit nahm ich jede Gelegenheit wahr, mir während der Freizeit noch etwas dazuzuverdienen. So half ich bei verschiedenen Festen am Ausschank, ich verkaufte Eis und Würstchen, holte die Scheiben beim Zielschießen ein, machte Nachtdienst bei den Abrechnungen für die kassenärztliche Vereinigung, tippte auf einer alten geschenkten Schreibmaschine Doktorarbeiten, sammelte in den Abendstunden bei verschiedenen Nürnberger Arztpraxen Blut-, Stuhl- und Urinproben für Laboruntersuchungen ein und anderes mehr. Die übrige freie Zeit nutzte ich für meine Weiterbildung in Abendkursen. Auch der Sport nahm in meinem Leben einen wichtigen Platz ein. Die anderen Familienmitglieder waren ebenfalls nicht untätig. Mutter und mein mittlerer Bruder trugen morgens um 5.00 Uhr bereits Zeitungen aus. Unsere ganze Familie tat alles Mögliche, um wirtschaftlich voranzukommen, und im Laufe der Jahre gelang uns das auch.
Beruflich boten sich mir keine allzugroßen Chancen, denn ich hatte außer meinem Handelsschulabschluß nichts aufzuweisen. All die von mir besuchten Abendkurse und Lehrgänge bereicherten zwar mein Wissen, hatten aber keinen Einfluß auf ein Weiterkommen bzw. auf eine gehaltliche Höhergruppierung. Wo immer ich auch versuchte, eine höherdotierte oder qualifiziertere Tätigkeit ausüben zu dürfen, wurde mir erklärt, daß hierfür höhere Schulbildung bzw. der Nachweis von Zeugnissen erforderlich sei. Auf diese Weise wurde mir immer wieder vor Augen geführt, welche Folgen eine Vertreibung aus der Heimat auf das ganze Leben eines Menschen hat.
Den Arbeitsplatz habe ich noch einige Male gewechselt. Wenn ich schon keinen höheren Schulabschluß nachweisen konnte, waren wenigstens die jeweiligen sehr guten Arbeitszeugnisse ein kleiner Trost für mich. Ich habe versucht, den diversen Arbeitgebern zu beweisen, daß ich auch mit nur wenigen Schuljahren das gleiche zu leisten in der Lage bin wie andere mit Abitur. Es ist mir niemals schwergefallen, mich neuen Anforderungen zu stellen und neue Aufgaben zu meistern. Aufgrund der mir durch Abendkurse angeeigneten Fremdsprachenkenntnisse schuf ich mir die Möglichkeit, mehrere Jahre meinen Beruf im Ausland auszuüben. Eigentlich habe ich während meines ganzen Lebens nie aufgehört zu lernen. Vielleicht holte ich damit unbewußt das nach, was mir in meiner Kindheit verwehrt geblieben ist. Leider hat sich ein Großteil meiner Kindheitswünsche nicht erfüllt, und die mir selbst gesteckten Ziele habe ich nicht erreicht.
Auch meine Eltern, die während ihrer Jugendzeit Zukunftsträume hatten und nur das Ende des Krieges abwarteten, um dann ihre Vorhaben in die Tat umsetzen zu können, sind vom Leben bitter enttäuscht worden. Mehrmals hatten sie zu einem besseren Dasein angesetzt, mehrmals standen sie vor dem Nichts. All diese körperlichen und seelischen Belastungen sind auch an ihnen nicht spurlos vorübergegangen. Mein Vater, der bis zu seinem 65. Lebensjahr gearbeitet hat, verbrachte die Jahre seines Ruhestands als Dahinsiechender. Die jeweiligen Aufenthalte im Krankenhaus waren von längerer Dauer als die in seinem Zuhause. Er erreichte nicht einmal das 73. Lebensjahr. Mutter überlebte ihn gerade um 5 Jahre. Sie, als Waise in einem Waisenhaus aufgewachsen, mußte ihr Leben nach einem Schlaganfall in einem Pflegeheim beschließen, denn wir Kinder waren zu jenem Zeitpunkt alle berufstätig und hatten keine Möglichkeit, sie bei uns aufzunehmen.
Wie gerne hätten meine Eltern ihr Jägerndorf noch einmal wiedergesehen. Es war ihnen nicht mehr vergönnt. Ich dagegen durfte meine Geburtsstadt wiedersehen, doch das, was ich sah, entsprach nicht dem Bild, welches ich in meiner Erinnerung mit mir trug.
Wiedersehen mit der Geburtsstadt Jägerndorf
Der Wunsch, irgendwann meine Geburtsstadt wiedersehen zu dürfen, war schon seit langem in mir wach. In früheren Jahren bestand dazu wegen der zwischen Deutschland und der Tschechoslowakei bestehenden geschlossenen Grenzen keine Möglichkeit. Jägerndorf liegt im Osten in unmittelbarer Nähe des Altvatergebirges. Eine Fahrt auf eigene Faust in dieses Gebiet, zumal noch ohne Sprachkenntnisse, erschien mir zu gewagt. Auch meine seinerzeit noch lebenden Eltern hätten eine solche Reise nicht angetreten, obwohl sie gerne an ihre Heimat dachten und sich die Bilder der Vergangenheit in ihrer Erinnerung noch sehr deutlich darstellten. Sie sprachen oft über ihre Stadt und stellten sich die Frage, wie es wohl heute dort aussieht. Gern hätten sie ihr Jägerndorf noch einmal gesehen und hofften stets auf eine spätere Gelegenheit, die sich ihnen nicht mehr bot. Der Tod kam ihrem Wunsch zuvor.
Im Herbst 1993 schloß ich mich einer Reisegruppe, bestehend aus überwiegend in Jägerndorf und Umgebung geborenen Heimatvertriebenen an. Es war für mich die erste Fahrt in die Heimat nach über 47 Jahren. Mit sehr gemischten Gefühlen und voller Erwartungen bestieg ich den Bus, der uns in das ehemalige Sudetenland bringen sollte. Der unfreiwillige lange Aufenthalt an der tschechischen Grenze, den ich als reinen Willkürakt des tschechischen Grenzpersonals deutschen Einreisenden gegenüber bezeichnen möchte, ließ mich ahnen, daß nicht alles so glatt ablaufen würde, vor allem aber, daß der Deutsche in seiner ehemaligen Heimat nicht unbedingt ein gern gesehener Gast ist.
Während der Fahrt erfuhr ich so einiges über die Geschichte meines Vaterlandes, so z. B., daß bereits zu Beginn des 13. Jahrhunderts ein mehr als hundert Jahre währender deutscher Siedlerstrom in das bewaldete und unbewohnte Altvaterland eingesetzt hatte, unsere deutschen Vorfahren also schon über Jahrhunderte hinweg in dieser Gegend lebten und nicht - wie heute behauptet wird - immer eine Minderheit in diesen Ostgebieten darstellten. Es wurden aber auch Hintergründe und politische Ereignisse angesprochen, die letztendlich zu den allen sudetendeutschen Vertriebenen bekannten Konsequenzen geführt haben. Offenkundig wurden jedoch auch Greueltaten seitens der Tschechen uns Deutschen gegenüber, die mir bisher unbekannt waren und deren Ausmaße meine eigenen Erfahrungen und das Vorstellungsvermögen überschreiten. Unter anderem hörte ich zum erstenmal eine Schilderung über den „Brünner Todesmarsch“, bei dem mehr als 1.500 unserer sudetendeutschen Landsleute ums Leben kamen. An vielen Orten hatten Tschechen gegen Deutsche gewütet, so unter anderem auch in Aussig, wo sich ein furchtbares Massaker abspielte. Viele waren zu Zwangsarbeit eingesetzt, viele in die Urangruben von St. Joachimsthal verbannt worden. Über drei Millionen Sudetendeutsche waren auf unmenschliche Weise aus ihrer Heimat hinausgetrieben worden. Über derartige Ereignisse, die einen Teil der Geschichte der Vertreibung darstellen, ist offensichtlich wenig veröffentlicht worden. So wie ich haben auch viele andere Landsleute meines Alters nichts von einem „Brünner Todesmarsch“, nichts von Vertriebenentrecks in die Gebiete der ehemaligen DDR u.a.m. gewußt und später auch nichts darüber erfahren. Es ist daher nicht verwunderlich, wenn Nichtvertriebene oder gar Menschen anderer Nationen über derartige Vorkommnisse nicht informiert sind. Gewisse Ereignisse wurden einfach totgeschwiegen, in Schulbüchern ist darüber nichts zu lesen.
Ich war erschüttert, als ich erfuhr, auf welche Weise die Brünner Bürger auf dem Weg Richtung Westgrenze von den Tschechen grausam niedergeknüppelt und erschlagen wurden. Wie war es möglich, daß sich bei den Tschechen ein derartiger Haß angestaut hat, der nun nach dem Ende des Krieges seinen Niederschlag in Form von Grausamkeiten unschuldigen Deutschen gegenüber fand?
Da uns die Reise über Brünn führte, passierten wir auch die Straße nahe Pohrlitz, wo sich am Straßenrand ein Eisenkreuz mit einer Gedenktafel befindet. Dieses vom österreichischen Schwarzen Kreuz gesetzte Zeichen ist das einzige Mahnmal, welches an die seinerzeitigen Grausamkeiten erinnert. Doch die Inschrift gibt nicht den wahren Sachverhalt des begangenen Unrechts wieder. Es heißt hier:
„Nach Ende des Zweiten Weltkrieges im Jahre 1945 sind viele deutschsprachige Einwohner aus Brünn und Umgebung ums Leben gekommen. 890 Opfer sind hier bestattet. Wir gedenken ihrer.
Österreichisches Schwarzes Kreuz - Kriegsgräberfürsorge.“
Als ich später vor diesem Kreuz stand und die Zahl der Opfer, die mit Sicherheit nicht die der tatsächlich Getöteten wiedergibt, las, erfaßte mich ein unbeschreibliches Entsetzen. Von „Bestattung“ kann hier bestimmt nicht die Rede sein, eher von einem Verscharren all dieser gemarterten Menschen. Wir befanden uns auf blutgetränktem Boden. Straßen, Wiesen und Felder bedecken die Leichname der Menschen, die hier so grausam und brutal zu Tode kamen. Menschen, die ihre Rettung in der Flucht gen Westen gesucht hatten. Sie waren im Glauben gelassen worden, zwar ohne ihr Hab und Gut, doch unbehelligt, ihre Heimat verlassen zu können. Doch kurz vor ihrem Ziel waren die Tschechen wie wilde Tiere über den Aussiedlertreck hergefallen und über tausend Menschen sind diesem Massaker zum Opfer gefallen. - Und die Geschichte schweigt darüber. Der heutigen Jugend werden derartige Vorkommnisse vorenthalten, sie werden falsch unterrichtet.
Bald wird durch diese Region eine Autobahn geführt. Man wird beim Bau die Überreste der Leichen Brünner Bürger finden. Doch werden diejenigen, welche die übriggebliebenen Knochen dieser Menschen ausgraben, wissen, was vor vielen Jahren hier geschah?
Es erscheint mir in diesem Zusammenhang angebracht, einige Sätze aus der „Sudetendeutschen Heimatkunde“ von Gebhard Heinrich zu zitieren:
„Der Zusammenbruch 1945 führte zu einer Gewaltlösung der Nationalitätenprobleme. Über drei Millionen Sudetendeutsche wurden entschädigungslos aus ihrer Heimat vertrieben. Noch ehe die Siegermächte auf der Potsdamer Konferenz am 2. August 1945 auf Drängen der Tschechen ihre Zustimmung zu einer 'humanen und ordnungsgemäßen Überführung' der deutschen Bevölkerung oder Teile derselben nach Deutschland gaben, hatten die Tschechen schon fast eine Million Menschen vertrieben.
Bei jedem Wetter wurden sie im Fußmarsch über die Grenzgebirge gejagt, oder wie Vieh in offenen Eisenbahnwaggons nach Deutschland abgeschoben, nachdem man ihnen alles nur irgendwie Wertvolle abgenommen hatte. Sagte doch Benesch selbst, den Deutschen dürfe nichts bleiben als ein Taschentuch zum Weinen.
241.000 Menschen haben die 'in humaner und ordnungsgemäßer Weise zu erfolgende Bevölkerungsüberführung' nicht überlebt. Sie wurden auf bestialische Weise gefoltert, eingekerkert und auf den Straßen der Vertreibung erschossen, erhängt oder erschlagen. Meist weiß man nicht einmal ob, geschweige denn wo, sie begraben sind.
Der Wert des durch die Vertreibung verlorenen privaten Vermögens der Sudetendeutschen wird nach gesicherten und allgemein üblichen Ermittlungsverfahren nach dem Stand von 1981 auf 265 Milliarden DM geschätzt. Zum Vergleich dazu: Die gesamten Steuereinnahmen der Bundesrepublik Deutschland beliefen sich 1981 auf rund 182 Milliarden DM.“
Nachdem wir die Grenze passiert hatten, verlief die Weiterfahrt reibungslos. Je weiter wir in mein ehemaliges Heimatland vordrangen, desto mehr wurde meine Seele mit Schmerz erfüllt. Welch herrliches Land! Die Gegend ist nur dünn besiedelt, die einzelnen Dörfer liegen weit verstreut in der Landschaft. Beim Durchfahren der einzelnen Ortschaften mit ihren zum Teil höchstens einstöckigen Häusern - in vielen Fällen bestehen sie nur aus dem Erdgeschoß mit kleinen fast ebenerdigen Fensterchen und tief heruntergezogenen Dächern - wurden Erinnerungen an meine Kindheit wach. Genauso präsentierten sich damals die ländlichen Gehöfte, ein Anblick, wie man ihn heute hier im Westen nicht mehr vorfindet. Es hatte sich nichts verändert, alles war so wie vor fast 50 Jahren. Die Dörfer sind auch nicht - wie in der Bundesrepublik - durch Neubauten erweitert worden. Sie haben ihren ehemaligen Charakter beibehalten. Was den Zustand der Baulichkeiten und der Dörfer insgesamt anbelangt, so stellte ich fest, daß nichts, aber auch wirklich nichts, erneuert oder renoviert worden ist. Der Putz fällt von den Wänden, die Fensterrahmen sind verrottet, die Holzzäune zusammengebrochen, Gärten und Umfeld zum Teil verwildert und mit Unrat übersät. Die Zeit ist hier, zumindest auf dem Land, stehengeblieben. Die neuen Besitzer unserer Güter haben es nicht für nötig befunden, das, was sie sich angeeignet haben, zu hegen und zu pflegen. Eine weitere erschreckende Erfahrung war die Tatsache, daß unser Bus mit deutscher Aufschrift und deutschem Kennzeichen mit bösen Blicken, zum Teil aber auch mit unübersehbar feindlichen Gesten seitens der Tschechen verfolgt wurde. Und wieder fragte ich mich, wie schon damals als Kind im Lager: Was haben wir den Tschechen getan, daß man uns mit solchem Haß begegnet?

Nach und nach tauchte die hügelige Landschaft, die den Reiz der Jägerndorfer Gegend ausmacht, auf. Im Kreise der Mitfahrenden wurden Orte genannt, deren Namen ich als Kind schon gehört hatte.
Wir näherten uns Jägerndorf. Viele Jahre hatte ich auf diesen Augenblick warten müssen! Die Tränen, die ich nun nicht mehr zurückhalten konnte, trübten meinen Blick. Im Hintergrund wurde der Burgberg mit der von weitem immer so klein wirkenden Kirche sichtbar. Dann tauchte am rechten Straßenrand das Ortsschild „Krnov“ auf. Viel lieber hätte ich „Jägerndorf“ darauf gelesen. Um meine Fassung war es geschehen. Ich weinte hemmungslos. Das, was ich in diesem Moment empfand, vermag ich nicht in Worte zu kleiden. Es war zum einen Freude über ein Wiedersehen mit dem Ort meiner Geburt und Kindheit. Aber auch Schmerz darüber, daß ich nun hier sein kann, während es meinen Eltern nicht mehr vergönnt ist, diesen Augenblick mitzuerleben. Gleichzeitig wurden jedoch auch Erinnerungen wach an all das Schreckliche, welches uns während des Lagerlebens hier widerfahren war.
Wir durchfuhren den ersten Teil des Stadtgebietes, den ich so nicht kannte. Es hat sich viel verändert. Vertraut geblieben ist mir der Anblick der Stadtkirche, des Stückchens Stadtmauer, der Parkanlage. Die Stadtmitte selbst zeigt ein mir völlig fremdes Gesicht mit Ausnahme des Rathauses. Wo sind die Laubengänge um den Rathausplatz, dessen Ausmaß sich etwa auf das Doppelte vergrößert hat, wo die kleinen Gäßchen, die zum Park führten? Die Beckengasse besteht nur noch aus einem Teilstück. Ich suchte den Minoritenplatz, das Haus, in welchem meine Großeltern gewohnt hatten. Es gibt keine Mühlgasse mehr, keinen Eislaufplatz. Dieses Jägerndorf ist nicht das, welches ich 1946 verlassen habe. Zum Teil hat man renoviert, zum Teil gräßliche Neubauten erstellt.
Ich hatte das Gefühl, als ob mein Brustkorb mittels eines Eisenreifes zusammengedrückt würde. Gleichzeitig aber tauchten Fragen in mir auf, Fragen nach Namen, nach Straßen, nach Begebenheiten. Oh, hätte ich doch in diesem Moment meine Eltern neben mir gehabt. So vieles aus meiner Kindheit kam mir in den Sinn.
Nun stand ich in meinem Jägerndorf. Ich erinnerte mich an die vielen Sonntagsausflüge, die ich damals mit den Eltern - natürlich zu Fuß - unternommen hatte. Wo waren wir immer hingewandert? Wo befindet sich die Brücke, an deren aufsteigenden Begrenzungen ich an der Hand des Vaters solange hochstieg, bis er mich nicht mehr halten konnte und ich in seine Arme hinunterspringen durfte? Auf welcher Straße, in welche Richtung, hatten wir jeweils die Stadt verlassen, um in den schönen Wald mit dem See zu gelangen, wo ich in einer Gastwirtschaft eine „Brause“ trinken durfte? Wo befindet sich das Haus von Tante E., wo das von Frau H., bei der ich manchmal Kakao erhielt? Wie heißt der Turm, auf den ich am liebsten bei jedem Ausflug gestiegen wäre? Der Schmerz in meiner Brust verstärkte sich. Ich bin in Jägerndorf, ich sehe viele vertraute Gebäude, auch wenn sie sich in einem verfallenen Zustand befinden, aber ich muß mit meinen Empfindungen und Gefühlen, mit meinen Erinnerungen und Fragen alleine fertig werden. Es gibt niemanden, der mit mir gemeinsam die Stätten der Kindheit aufsuchen, mir Auskunft und Erklärungen geben kann. Vor meinem geistigen Auge tauchen die Gesichter meiner Eltern auf. Ich sehe ihre glänzenden Augen, ihre Bewegtheit, wenn sie von Jägerndorf und den vergangenen schönen Zeiten dort sprachen. In meiner Phantasie stehen die Eltern neben mir, doch die Realität holt mich schnell wieder ein. Ich bin hier, und nicht sie, deren Wunsch es war, einmal noch nach Jägerndorf zurückkehren zu können.
Ich hatte die Stadt viel größer in Erinnerung, das wurde mir jetzt bewußt. Diese Größenvorstellung hängt sicher damit zusammen, daß ich damals selbst noch klein, also keine 11 Jahre alt war. Der Weg von der Troppauer Brücke bis zum Bahnhof ist mir seinerzeit immer unendlich lang, die Häuser wesentlich höher erschienen. Diese Erkenntnis schmälert jedoch nicht die Einstellung zu meiner Geburtsstadt Jägerndorf, den Ort, an dem ich meine Kindheit, und mag sie auch noch so bescheiden gewesen sein, verbracht habe.
Und diese Stätten meiner Kindheit wollte ich wiedersehen. Obzwar Jahrzehnte vergangen sind und sich vieles, auch an der Straßenführung, verändert hat, versuchte ich, mich an Wege und Gebäude zu erirn. Doch nicht nur Kindheitserinnerungen wurden wach. Offensichtlich hatte ich vieles, was sich nach dem Kriege ereignet hatte, verdrängt. Erst hier, am Ort des Geschehens, ließ mein Unterbewußtsein wieder einiges von dem an die Oberfläche, was jahrzehntelang verschüttet geblieben war. Auf dem Weg zum und vom Burgberg kam die Erinnerung, daß ich vor 47 Jahren hier oben im Burgberglager am Stacheldrahtzaun gestanden und mich gefragt habe, ob ich diesen glänzenden Rathausturm wohl jemals wiedersehen würde. Fast glaubte ich, die Melodie des Liedes „Heimat deine Sterne“, das die beiden jungen Frauen am Vorabend unserer Aussiedlung sangen, zu hören. Der Aussichtsturm, vor dem ich nun stand, übte nach wie vor den alten Reiz auf mich aus. Ich mußte hinauf, auch wenn - was ich schon fast als diskriminierend empfand - der Eintrittspreis für Deutsche doppelt so hoch ist wie der für Tschechen. Beim Anblick der Jubiläumsschule, deren Fassade, Türen und Fenster sich in einem erbärmlichen Zustand befinden, dachte ich an meinen ersten Schultag im Jahre 1941. Später besuchte ich die Mädchenschule im Park. Selbstverständlich versäumte ich nicht, auch diese Gebäude aufzusuchen. Was hätte ich beruflich und allgemein im Leben nicht alles erreichen können, wäre es mir vergönnt gewesen, meine so vorbildlich begonnene Schulausbildung hier abschließen zu können. In einem anderen Schulgebäude nahe des Friedhofes befand sich seinerzeit die Turnhalle, in der ich das sogenannte „Freiturnen“ ausüben durfte. Turnen gehörte schon immer zu meinen Lieblingsbeschäftigungen, und so ließ ich an meinem geistigen Auge Geräte und Übungen an mir vorüberziehen.

Der Stadtpark selbst hat nicht mehr die seinerzeitige Ausdehnung, es fehlen die weitläufigen Blumenanlagen. Er war früher auch wesentlich gepflegter. Das mag wohl unter anderem auf die Tatsache zurückzuführen sein, daß zur damaligen Zeit die „Parkwächter“ für Ordnung und Sauberkeit sorgten. Wir Kinder wagten nicht, auch nur einen Fuß vom Wege ab in den Rasen zu setzen. Die Wächter waren allgegenwärtig und sie flößten uns Respekt, manchmal auch Angst ein. Nicht selten mußte ein Kind, welches sich nicht gebührlich aufgeführt oder einen Fetzen Papier auf die Erde geworfen hatte, eine Ohrfeige einstecken. Da half auch keine Beschwerde im Elternhaus. Allenfalls hatte man noch die andere Wange hinzuhalten. Der Parkwächter genoß den Ruf einer Autorität, der man gehorchte.Mit Tränen in den Augen setzte ich meinen „Spaziergang durch die Kindheit“ fort. Obwohl ich immer wieder versuchte, die in mir wühlenden Gefühle in geordnete Bahnen zu lenken, gelang es mir nicht. Erinnerungen, Wehmut, Trauer, Schmerz, Wut und Freude - dies alles in Einklang zu bringen, um offenen Auges und in neutraler Betrachtungsweise meinen Weg fortzusetzen, war nicht möglich.Ich hoffte, ein wenig inneren Frieden auf dem Friedhof zu finden. An den Baulichkeiten am Eingang hat sich nichts verändert. Obwohl ich fast sicher war, die Ruhestätte meiner Großmutter nicht mehr vorzufinden, suchte ich dennoch danach. Wie oft hatte ich früher das kleine in den weißen Stein eingelassene Bildchen betrachtet, da meine Großmutter schon sehr früh gestorben war und ich kaum noch eine Vorstellung von ihrem Aussehen hatte. Auch meine Suche nach Fragmenten von Steinen an den Rändern des Friedhofes blieb erfolglos. Der Besuch des Friedhofs hatte mir jedenfalls keine innere Ruhe verschafft. Aufgewühlt wie vorher betrat ich wiederum den Park.
Der nächste Weg führte mich in die Anzengrubergasse zu dem Haus, aus dem wir damals so brutal herausgerissen worden waren. Schon als ich mich dem Haus näherte, stellte ich fest, daß das vormals gut gepflegte Umfeld fehlte. Der Garten ist verwildert, der herrliche Zedernbaum und die Büsche vor dem Haus sind nicht mehr vorhanden. Das Gebäude selbst, früher einmal hellgrau getüncht, zeigt sich schmutzig dunkel.
Da stand ich nun, wieder einmal weinend - das war mittlerweile ein Dauerzustand geworden - und schickte meine Gedanken hinter die Eingangstür, die Treppen hinauf zu unserer Wohnung. Mein Gefühl sagte mir, daß sich dort oben noch unsere Möbel und Einrichtungsgegenstände befinden könnten. Meine Eltern hatten sich seinerzeit gerade neu eingerichtet. Im Geiste sah ich die Bilder an den Wänden, meinen Puppenwagen in der Ecke, das Stühlchen neben dem Kachelofen. Sehnsüchtig suchten meine Augen eine Bewegung hinter den Fensterscheiben. Lange hatte ich mit mir gerungen, doch jetzt war ich entschlossen, an der Tür zu läuten. Auch ohne Sprachkenntnisse wollte ich versuchen, mich verständlich zu machen, zu erkennen geben, daß ich nichts haben, sondern nur noch einmal sehen möchte. Es zerriß mir fast das Herz. Da stand ich nun vor dem Haus, in dem sich unser Eigentum befand, das jetzt fremde Menschen für sich in Anspruch genommen haben.
Offensichtlich stand ich zu lange vor dem Gebäude, denn mittlerweile wurde ich argwöhnisch von Gesichtern auf der gegenüberliegenden Straßenseite betrachtet. Diese Blicke verhießen nichts Gutes. Es verließ mich der Mut. Wäre ich der tschechischen Sprache mächtig, hätte dieser Versuch des Wiedersehens unserer Räume einen anderen Ausgang genommen. So aber blieb mir nichts anderes übrig, als, innerlich ausgebrannt und enttäuscht, den Rückweg anzutreten. Und ich wußte, hier in diesem Haus, im ersten Stock, sind all die Dinge zurückgeblieben, die sich meine Eltern vom Munde abgespart hatten, auf die sie stolz waren. Dort oben hatte ich während der strengen Winter am Morgen immer ein Loch in die mit Eisblumen bedeckten Fensterscheiben gehaucht, von dort hatte ich die Vögelchen im Zedernbaum beobachtet. Hier war ich lesenderweise mit meinen Märchenbüchern gesessen, die alle zurückgeblieben sind. An diesem Fenster war ich gestanden, als mein Vater, einen alten Kinderwagen vor sich herschiebend, vom Krieg zurückkehrte. Es tat weh, sehr weh, als ich den Rückweg Richtung Park antrat. Der Schmerz um all das Verlorene bezieht sich keineswegs nur auf materielle Güter - während des Krieges und danach verlief das Leben ohnehin bescheiden. Nein, ich habe ein Stück Kindheit, ein Stück Leben verloren. Das kann durch Geld nicht aufgewogen werden.
Am nächsten Tag setzte ich meinen traurigen Gang durch die Vergangenheit fort. Der jüdische Friedhof vor der Stadt stand auf meinem Plan. Das Gräberfeld war etwas verwahrlost, aber die Grabsteine mit deutschen Inschriften sind erhalten geblieben. Die Synagoge, an der ich später vorbeikam, die während der Nazizeit frevelhafterweise als Gemüse- und Fischhalle mißbraucht worden war, dient nunmehr einem anderen Zweck.
Der Anblick der Troppauer Brücke rief mir das seinerzeit hier in der Nähe befindliche Troppauer Lager in Erinnerung. Welch qualvolle Zeit hatten wir hier verbracht, welch Hunger gelitten, wieviele sind auf diesem Stück Erde eines gewaltsamen Todes gestorben. Es war mir, als hörte ich noch die Schreie der geprügelten und mißhandelten Menschen, die Sirene, die zum Absingen des Deutschlandliedes aufrief. Ich sah mich in der Reihe der Wartenden stehen, hoffend, diesmal ein Stückchen Brot zu erhalten. In jenem Augenblick, also 47 Jahre später, wünschte ich mir, meiner Mutter wenigstens etwas von dem zurückgeben zu können, was sie sich damals schwer erarbeitet, vom Munde abgespart und uns abends ins Lager mitgebracht hatte. Der Tod hat eine Mauer zwischen Wunsch und Tat errichtet. Aber nicht nur das Bild meiner Mutter stand mir vor Augen. Unwillkürlich kratzte ich an meinen Händen, auf meinem Kopf. Sogar die Ungezieferplage war mir im Gedächtnis haften geblieben und machte sich jetzt körperlich wieder bemerkbar.
Ich lenkte meine Schritte wieder Richtung Rathaus. In diesem Umfeld hat sich so viel verändert, daß es schwerfiel, mir Wege und Gäßchen vorzustellen. Auch wenn ich immer wieder auf die leere Fläche des Minoritenplatzes starrte, die ehemals bestehende Häuserzeile nahm keine Gestalt in meiner Erinnerung an. Wo waren die Gebäude des Heider-Bäckers, der Konditoreien Dorant und Stein, wo der kleine Bach an der Ecke, das Gäßchen, welches zum Eislaufplatz führte? Nichts davon ist vorhanden geblieben. Gerade an diesen Stätten hatte ich die ersten Jahre meiner Kindheit verbracht, hier spielte ich mit herumliegenden Gänse- und Hühnerfedern, die mir als Pinsel zum Malen dienten. Hier hatte ich meine Löcher gegraben, um bunte Kügelchen hineinzuschieben, hier ließ ich auf ebener Erde meinen Kreisel tanzen und spielen. Und im Winter verbrachte ich viele Stunden auf dem Eislaufplatz. Auch diesen Platz gibt es nicht mehr.
Sehnsüchtig hatte ich damals immer auf die weißen Schlittschuhe der kleinen Kunstläuferinnen geschaut, die ihre Achter innerhalb der abgesperrten Fläche fuhren. Ich hatte geübt und geübt, um irgendwann einmal ebenfalls mit weißen Schuhen brillieren zu können. Diesen Wunsch hatte ich meiner Mutter gegenüber immer wieder vorgebracht, obwohl ich ihre Antwort bereits kannte: „Do wirste noch a bißle worten missen. Wenn de dann ai der Schule a scheenes Zeignis kriegst, reden ma noch amol driber.“
Ein kleines Geldstück hatte ich damals immer von meiner Mutter bekommen, das ich stolz der „Anziehfrau“ überreichte - so wurde sie von den Kindern genannt - um mir beim An- und Ausziehen helfen lassen zu können. Meist hatte ich nach dem Laufen dermaßen erfrorene Hände, daß ich trotz der wohlig warmen Temperatur, die im Holzpavillon herrschte, nicht in der Lage war, einen Knopf zu öffnen oder zu schließen, geschweige denn Schlittschuhe aufzubinden. So durfte ich mich auf die Holzbank setzen und bedienen lassen.
Dieser einstmals so stark frequentierte Eislaufplatz gleicht heute einer Schutthalde. Der Pavillon ist erhalten geblieben und dient der Jugend als Diskothek. Ich empfinde den Verlust dieses Eislaufplatzes als schmerzhaft, prägte er doch das Jägerndorfer Stadtbild mit, und erfreute Läufer und Zuschauer, die sich an den Künsten und Ungeschicklichkeiten der Menschen auf dem Eis ergötzten, gleichermaßen. Die ganz Kleinen saßen immer dick vermummt, die Händchen zusätzlich in einem Muff versteckt, in kunstvoll geschmiedeten, von ihren Eltern geschobenen Kufenstühlen. Die Anfänger, zu denen auch ich einmal gehörte, hielten sich an Holzgestellen fest. Ich höre noch die Stimme meiner Mutter: „Nimmder a Ritsche, doß de nie hinfliegst“. An Publikum fehlte es nie. Besonders an Sonntagen war das Holzgeländer oberhalb des Platzes belagert.
Natürlich gab es auch weniger schöne Kindheitserinnerungen, die mit Örtlichkeiten verbunden waren, deren Anblick mir früher immer Angst einflößte. Dazu gehörte auch das Gaswerk. Nun befand ich mich auf einem Spaziergang durch die Vergangenheit, und der Weg führte mich, am Krankenkassengebäude vorbei, Richtung Gaswerk. Hierher hatte mich meine Mutter fast täglich gebracht, als ich am Keuchhusten zu ersticken drohte. Ich mußte jeweils eine halbe Stunde in einem der Räume des Werkes still sitzen und die Gasluft einatmen. Es war unheimlich, so ganz allein in dieser großen Halle zwischen all den Rohren und Kesseln eine mir sehr lang vorkommende Zeit verbringen zu müssen. Mutter wartete jeweils draußen. Nur wenige Male hatte ich das Glück, noch ein anderes Kind auf dieser Bank sitzend vorzufinden. Ich fühlte mich dann sicherer. Durch diese Therapie sollte der Keuchhusten gemildert, wenn nicht gar geheilt werden. Irgendwann hatte ich diese Hustenanfälle auch überwunden. Ob es wirklich der gasgeschwängerten Luft zu verdanken war, mag dahingestellt bleiben. Gerne kam ich hier nicht her.
Anders verhielt es sich mit der eisernen Eisenbahnbrücke, die ich am liebsten jeden Tag aufgesucht hätte. Der Weg dorthin und darüber hinweg gehörte mit zu unseren sonntäglichen Standardausflügen. Als ich diese Brücke nach so vielen Jahren wieder sah, traten mir abermals die Tränen in die Augen. Wie glücklich war ich als Kind, wenn ich, oben auf der Brücke stehend, von einem darunter hinwegfahrenden Zug vom Dampf der Lokomotive eingehüllt und somit für meine unten wartenden Eltern unsichtbar wurde. Auf diesen Moment hatte ich mich schon immer im voraus gefreut. Nach über 40 Jahren bestieg ich nun wieder diese Brücke, deren Aussehen fast unverändert geblieben ist. Sie erschien mir nur wesentlich niedriger als ich sie in Erinnerung hatte. Ich stand oben und wartete unwillkürlich auf die Dampflokomotive. Es kam keine - es wird nie wieder eine kommen. Kein Rauch, kein Dampf wird mich mehr einhüllen. Und die Gesichter meiner Eltern, die mir immer zulachten, sobald ich wieder in ihr Blickfeld trat, werde ich auch nicht mehr sehen.
Auf dem Rückweg zur Stadtmitte suchte ich den dicken hölzernen Wasserturm, durch dessen Astlöcher ich so gerne ins Innere geschaut und die Tropfen gezählt habe. Er ist weg. Ebenso wie die Zeit der Kindheit unwiderruflich vorbei ist, existieren auch viele Gebäude und in meiner Erinnerung verhaftete Landschaftsbilder nicht mehr. So bescheiden und ärmlich unsere Kindheit auch gewesen sein mag, wir haben nichts vermißt und waren glücklich.
Wiedergefunden habe ich dagegen das Gebäude auf dem Masarykplatz, in dem wir zuletzt wohnten und in dem sich das Elektrogeschäft des Herrn Slovácek befand. Nunmehr liegen andere Artikel in den Schaufenstern. Der Anblick dieses Hauses weckte gute und schlechte Erinnerungen. Zu diesen Erinnerungen gehört die Tatsache, daß sich in diesem Haus, eingemauert im obersten Stockwerk, die „Schätze“ meines Vaters befinden, die er sich irgendwann wieder holen wollte, wäre er nach Jägerndorf zurückgekehrt. Das Gebäude mit seinem Flachdach und der Balustrade ist unverändert, wenngleich auch hier der Zahn der Zeit an Fassade, Fensterrahmen und Haustür genagt hat. Man hat nicht viel getan, um die Bausubstanz dieses Hauses zu erhalten, aber es ist - im Gegensatz zu vielen anderen - „anschaubar“ geblieben. Unschlüssig trat ich an die Haustür. Sie war unverschlossen. Es reizte mich, das Treppenhaus zu betreten und nach oben zu gehen. Doch welche Erklärung hätte ich abgeben wollen, wäre ich angesprochen worden? Welche Konsequenzen hätte eine Begegnung mit einem Hausbewohner für mich, eine Deutsche, gehabt? Und wie sollte ich mich verständlich machen, ohne die Sprache zu sprechen?
Lange habe ich mit mir gekämpft, ehe ich mich entschloß, im Treppenhaus herumzuschleichen. Ich gelangte bis ins oberste Stockwerk. Dort entdeckte ich auch den Eingang zum Flachdach, allerdings hat man diesen Hausraum als Abstellkammer mit einbezogen. Ich befand mich inmitten von Schuhen, Spielsachen und Gerümpel. Nun wagte ich es nicht mehr, weiter zu forschen. Ob es den Taubenstall als Aufbau auf dem Flachdach noch gibt, konnte ich nicht herausfinden. Mein Herz klopfte zum Zerspringen. Zum einen war es die Erregung, so nahe an den von meinem Vater eingemauerten Gegenständen zu sein, zum anderen war es die Angst, von jemandem gesehen zu werden. Schließlich befand ich mich in einem fremden Gebäude inmitten von Gegenständen, die nun anderen Menschen gehören.
Während ich hier stand, unfähig, mich zu bewegen, hörte ich Schritte. Eine Frau kam die Treppe herauf. Zunächst war ich vor Schreck wie gelähmt. Doch dann stieg ich die Treppe hinunter, schweigend an der Frau vorbei, die mich mißtrauisch und fragend anblickte. In diesem Moment hatte ich nur den Wunsch, schnell aus dem Haus zu kommen. Aufatmend erreichte ich die Straße. Ob sich unser Eigentum noch dort oben befindet, ob es je jemand ans Tageslicht bringen wird, diese Frage bleibt unbeantwortet. In meinem Inneren jedoch brodelte es.
Beim Anblick dieses Hauses dachte ich mit Dankbarkeit an den seinerzeitigen Arbeitgeber meines Vaters, Herrn Slovácek, der uns, die Familie, aus dem Troppauer Lager herausgeholt hatte und der meinen Vater als Mitarbeiter nicht verlieren wollte.
Das ausgestellte Zeugnis, welches – um eigene Schwierigkeiten zu vermeiden – vorsichtig formuliert ist, enthält nur wenig von dem, was meinem Vater an Lob und guten Wünschen zuteil wurde. Mehrmals hatte Herr Slovácek meinen Vater gebeten, seine Entscheidung zu überdenken. Oft hatte er ihm nahegelegt, die tschechische Staatsbürgerschaft anzunehmen und in Jägerndorf zu bleiben. Doch meine Eltern waren Deutsche und wollten es auch bleiben, ebenso wie ihre Vorfahren. Vater hatte nicht die Absicht, ein Leben lang in einem Radiogeschäft zu arbeiten. Er strebte eine Laufbahn als Beamter an. Dank seiner Kenntnisse und Fähigkeiten konnte er diesen Wunsch bei der Post verwirklichen.
An dieser Stelle möchte ich eine Einfügung anbringen, die meine Schilderung der Wiedersehenserlebnisse in Jägerndorf unterbricht. Die Erinnerung an das korrekte und menschliche Verhalten des Herrn Slovácek unserer Familie gegenüber weckte in mir den Wunsch, Kontakt zu seinen Kindern aufzunehmen, die in etwa dem gleichen Alter sind wie mein Bruder und ich. Mit Unterstützung tschechischer Bekannter konnte ich die Adressen der Tochter und des Sohnes vom mittlerweile verstorbenen Herrn Slovácek ausfindig machen. Ich hatte das Bedürfnis, meinen Dank auszusprechen. Nachfolgend der Wortlaut des an die Slovácek-Tochter gerichteten Briefes. Ein ähnlicher Text ging auch an den Sohn:
„Sehr geehrte Frau Dr. K...,
dank der Hilfe des jungen Journalisten Pavel S. aus Jägerndorf habe ich endlich Ihre Anschrift erfahren.
Pavel teilte mir mit, daß Ihr Mann gut deutsch spricht, so daß es sicher keine Probleme mit der Verständigung geben wird. Er sagte mir auch, daß er Ihnen die tschechische Übersetzung meines Büchleins „50 Jahre nach der Vertreibung“ übersandt hat. Die tschechische Ausgabe ist etwas komprimiert, also nicht ganz so ausführlich wie mein deutscher Text.
Doch nicht mein Büchlein ist der Grund dafür, daß ich mit Ihnen in Kontakt treten wollte. Es ist mir ein Anliegen, einfach „danke“ zu sagen für all das, was Ihr Vater für uns getan hat.
Leider ist es nicht mehr möglich, meinen Dank Ihrem Vater gegenüber persönlich auszusprechen. Ebenso wie meine Eltern mittlerweile tot sind, lebt auch Ihr Vater nicht mehr. Ich habe erfahren, daß er am 30.10.1965, Ihre Mutter am 13.3.1988 in Jägerndorf/Krnov verstorben ist.
Sie sind etwa so alt wie ich und erinnern sich vielleicht nicht mehr an Ihre Kinderzeit in Jägerndorf. Ihren Bruder Jiri, geboren 1941, habe ich nur ein- oder zweimal gesehen. Sie selbst besuchten uns jedoch in der Wohnung des Hauses Masarykplatz, in dem Ihr Vater das Elektrogeschäft besaß. Ihr Besuch bei uns ist mir gut in Erinnerung geblieben. Ich besaß ein großes Puppenhaus mit mehreren Zimmern. Mein Vater, Elektriker, hatte in alle Zimmer dieses Puppenhauses kleine Lampen gehängt. In der Dunkelheit konnte man durch die Fensterchen des Puppenhauses die beleuchteten Puppen-Zimmer sehen. Während ich von anderen Kindern immer geschlagen wurde, haben Sie - und Sie sind ja auch Tschechin - mit mir gespielt. Das war für mich etwas Besonderes: Ein tschechisches Mädchen spielt mir mir!!
Ihr Vater hat sich unserer Familie gegenüber immer sehr aufgeschlossen gezeigt. Wenn meine Eltern Sorgen hatten, gleich welcher Art, konnten sie zu Ihrem Vater gehen. Er hat immer geholfen, was in der damaligen Zeit keine Selbstverständlichkeit war. Ihr Vater, Josef Slovácek, geboren im Jahr 1904, war etwas älter als mein Vater. Vielleicht hatte er deshalb so viel Verständnis für uns, weil er selbst zwei Kinder hatte und sich in die Lage von Eltern versetzen konnte, die nicht wußten, wie sie ihre Kinder sattbekommen sollten.
Wie Sie wissen, gab es im Jahre 1946 für uns Deutsche keine Zukunft in unserer sudetendeutschen Heimat. Das wußte auch Ihr Vater, und deshalb hat er meinen Vater nicht gezwungen, in Jägerndorf bzw. in seinem Geschäft zu bleiben. Viele andere Ihrer Landsleute ließen deutsche Fachkräfte nicht aus dem Lande. Der Abschied von Jägerndorf, aber auch von Ihrem Vater, ist meinen Eltern damals nicht leichtgefallen. Auch Ihr Vater hat es sehr bedauert, einen so guten Facharbeiter, wie meinen Vater, verlieren zu müssen.
Wie Sie vielleicht in meinem Büchlein gelesen haben, war der Anlaß für diesen Bericht mein Wiedersehen mit meiner Geburtsstadt nach 47 Jahren. Als ich das Haus am Masarykplatz, in dem Ihr Vater das Elektrogeschäft betrieb, sah, fiel mir meine Kindheit wieder ein. Das Elektrogeschäft gibt es nicht mehr. Jetzt werden andere Artikel verkauft. Aber allein der Anblick dieses Hauses rief viele Erinnerungen wach und es war mein großer Wunsch, mit Ihnen in Verbindung zu treten und Ihnen zu danken, nachdem ich Ihrem Vater jetzt nicht mehr danken kann. Würden meine Eltern noch leben, dann wäre es ihnen ebenso ein Anliegen, Ihnen zu sagen, wie sehr wir Ihren Vater geschätzt haben.
Ich hoffe sehr, daß Sie mir nicht böse sind, daß ich Ihre Familie in meinem Büchlein erwähnt habe. Alles, woran ich mich erinnerte, habe ich in diesem Bericht niedergeschrieben. Leider sind meine Erinnerungen überwiegend negativer Art mit Ausnahme der Zeit, in der mein Vater bei Ihrem Vater arbeitete. Deshalb wollte ich auch diesen für uns positiven Zeitraum mit erwähnen.
Mit allen guten Wünschen für Sie und Ihre Familie verbleibe ich
mit freundlichen Grüßen“
Auf meine Briefe, die nicht als unzustellbar zurückgeschickt wurden und folglich die Empfänger erreichten, erhielt ich keine Antwort, was mich sehr enttäuschte. Will oder darf Frau K., die Tochter Slováceks, heute Juristin, keinen Kontakt mit Deutschen haben? Schämt sie sich der deutschfreundlichen Haltung ihres Vaters? Die Gründe für dieses Verhalten werde ich niemals erfahren.
Das Wiedersehen mit Jägerndorf hat neben einer gewissen Freude viele Erinnerungen wachgerufen, aber auch alte Wunden aufgerissen. Auf Schritt und Tritt wurde ich von der Vergangenheit eingeholt. Meine Kindheit wurde mir vor Augen geführt, eine Zeit in Bescheidenheit, wie man sie heute keinem Kind mehr zumuten würde. Ich habe damals nichts vermißt, ich kannte es nicht anders. Schmerzlicher dagegen war die Zeit nach dem Kriege, die schrecklichen Monate in den Lagern, die erlittenen Demütigungen durch die Tschechen, der Hunger, die Not.
Ich befand mich nun in meinem Jägerndorf, in meiner Geburtsstadt, deren heutige Bewohner mir feindlich gesinnt sind und denen ich weder als Kind, noch später etwas zuleide getan habe. Wiederum liefen Tränen über mein Gesicht, der in meinem Inneren tobende Schmerz ist nicht zu beschreiben. Alles, was wir besaßen, haben wir verloren, wurde uns brutal weggenommen: Unsere unbeschwerte Kindheit und Jugend, unsere Zukunftsträume, vor allem aber unsere wunderschöne sudetendeutsche Heimat mit ihren Hügeln, Wäldern, Bergen, Bächen und Seen. Geblieben ist die Erinnerung, verbunden mit der Frage, wie unser Leben ohne verlorenen Krieg verlaufen wäre. Sicher wären wir - wie unsere Vorfahren - in der Heimat geblieben. Unsere persönlich gesteckten Ziele hätten wir wahrscheinlich erreicht. Viel Leid wäre uns erspart geblieben. Und unser in jeder Hinsicht blühendes Land hätte einen weiteren Aufschwung genommen. Viele Felder lägen nicht brach, die Häuserfassaden wären nicht abgebröckelt, große Bauwerke stünden noch heute in ihrer vollen Pracht da und würden Zeugnis geben vom Fleiß und der Heimatliebe meiner Landsleute.
Die Tschechen haben sich zwar unseres Hab und Guts bemächtigt, es aber nicht in Ehren gehalten und gepflegt.
Ich möchte nicht versäumen, an dieser Stelle einige Zeilen aus „Kulturelle Arbeitshefte Nr. 16 - Die Sudetendeutschen. Eine Volksgruppe im Herzen Europas“, herausgegeben von der Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn, anzuführen:
„Die Sudetendeutschen haben - und hatten in ihrer Geschichte - immer Anteil an der europäischen Kultur. Ihre kulturellen Leistungen waren geprägt durch den Geist des Zusammenlebens mit dem tschechischen Volk in Böhmen und Mähren; sie waren eingebettet in die Kulturleistungen des deutschen Volkes überhaupt.
So können die Sudetendeutschen auf eine große geistig-kulturelle Vergangenheit zurückblicken. Vom Minnegesang angefangen - der böhmische König Wenzel II. (1278 - 1305) dichtete in deutscher Sprache - über die Gestaltung der neuhochdeutschen Schriftsprache, die sich im ‘Ackermann aus Böhmen (1400)’ widerspiegelt, bis in die neueste Zeit haben Sudetendeutsche auf allen Gebieten ihren großen Beitrag zur deutschen und zur Weltkultur geleistet.“
Das nachstehende Gedicht eines unbekannten Verfassers soll verdeutlichen, in welch seelischer Verfassung und innerer Zerrissenheit sich die Menschen nach der Vertreibung befanden. Dieser „Aufschrei“ muß unmittelbar nach der Vertreibung - vielleicht im Jahre 1946 - entstanden sein, also in einer Zeit, in der die Seele schmerzte und die Wunden noch bluteten. Hierin hat der Autor all seine Gefühle zum Ausdruck gebracht: den Schmerz, die Enttäuschung, den Zorn und die Verbitterung. Gleichzeitig erhebt er aber schonungslos Anklage gegen die Vertreiber. Und dennoch räumt er auch der Hoffnung auf eine Wiederkehr Raum ein. Trotz all der Schreie seiner Seele, die in diesem Gedicht zum Ausdruck kommen, betont er:
„Nicht Vergeltung und nicht Rache sei sudetendeutsche Sache.“
Sudetendeutscher Schwur
Hebt die Hände, laßt uns schwören,
und der Herrgott soll es hören!
Niemals wollen wir vergessen,
was Urväter schon besessen:
Uns'rer Heimat blum'ge Auen,
die nun fremde Augen schauen.
Uns're Fluren, uns're Felder,
uns're Wiesen, uns're Wälder,
uns're Burgen, uns're Schlösser,
uns'res Landes heilende Wässer.
Bächlein nicht, nicht Fluß noch Berge,
uns're Wiegen, uns're Särge,
uns're Häuser, uns're Stuben,
uns geraubt von Lotterbuben.
Sagen nicht, nicht Heimatweisen,
die Sudetenschönheit preisen.
Nicht die Tänze, nicht die Reigen,
uns Sudetendeutschen eigen!
Hebt die Hände, laßt uns schwören,
Freund und Feinde soll'n es hören!
Woll'n des Rechts uns nie begeben
auf die Heimat, wollen streben,
sie uns wieder zu erwerben
für uns selbst und uns're Erben.
Um sie wieder zu erringen,
woll'n wir jedes Opfer bringen.
Nein, wir wollen nie vergessen,
was in Ehren wir besessen.
Nein, wir wollen nicht auf Erden
Knechte in der Fremde werden.
Nein, wir wollen nicht belasten
die, selbst arm, dem Brot nachhasten.
Nein, wir woll'n sie nicht berauben
um den eig'nen Zukunftsglauben!
Hebt die Hände, laßt uns schwören,
Erd' und Himmel soll'n es hören!
Herr, wir flehen, bitten beten.
Steh' uns bei in uns'ren Nöten!
Herrgott laß uns nicht verzagen.
Hilf das schwere Kreuz uns tragen.
Stärke Glauben uns und Hoffen,
halt das Tor zur Heimat offen!
Lenker aller Welten, rette
uns're Dörfer, uns're Städte
aus den Händen der Tyrannen,
die auf unser Ende sannen.
Die, brutal, in Staatesnamen
unseren Besitz sich nahmen.
Die Gewaltgesetze schrieben,
und uns aus der Heimat trieben.
Die durch Blut und Tränen schritten,
die verlachten alle Bitten
um ein menschliches Erbarmen.
Die die Mütter aus den Armen
ihrer Kinder hohnvoll rissen,
wehrten letzten Abschiedsküssen.
Die in endeloser Kette
stahl'n und raubten um die Wette,
die die Herzen uns zertraten
als wir sie um Schonung baten.
Uns zu Greuelfilmen jagten,
Eintrittsgeld zu nehmen wagten.
Die uns „Judenkarten“ gaben,
uns mit „N“ gezeichnet haben,
die für keinen Gnade kannten,
uns nur deutsche Schweine nannten.
Räuberbanden, die vermessen
auf den lieben Gott vergessen,
uns're Priester selbst nicht schonten,
die in Kohlengruben frohnten,
die die Seelen uns gestohlen,
als sie „Heim ins Reich“ befohlen,
hungernd uns in Lager stießen,
wo die Kräfte uns verließen,
wo's vor Ungeziefer strotzte,
wo man mit den Flinten protzte,
die uns anspien, peitschten, schlugen,
nahmen, was am Leib wir trugen.
Hunderttausend ließen sterben
und am Straßenrand verderben.
Die, gleich Teufeln, über Leichen
schritten, ohne zu erbleichen.
Alle, die den Freitod suchten,
ihren Mördern letztmals fluchten.
Alle, deren Blut vergossen,
bleiben uns're Weggenossen.
Alle, die in Not gestorben,
die, der Heimat fern, verdorben,
die erlitten Marterqualen,
Legion sind ihre Zahlen:
Alle bleiben unvergessen -
Wehe, wird die Schuld gemessen.
Hebt die Hände, laßt uns schwören,
jeder Tscheche soll es hören!
Keiner von Euch hat gesprochen
für uns in den Leidenswochen!
Mag man auch die Welt betrügen,
uns're Heimat straft sie Lügen!
All die namenlosen Gräber
bleiben Anklageerheber.
All die Grüfte unserer Lieben,
die in Heimaterde blieben.
Uns're Kirchen und Matriken
trotzen allen Feindestücken.
Sprechen deutlicher als Taten,
wer gelogen, wer verraten.
Daß wir Herrn auf Grund und Boden,
den Urväter mußten roden.
Daß wir dort seit ew'gen Zeiten
leben und das Brot bereiten.
So kann nie die Welt vergessen,
daß im Land wir erbgesessen.
Hebt die Hände, laßt uns schwören,
einmal muß die Welt es hören!
Dort, wo uns're Berge winken,
wo die heim'schen Wasser blinken.
Dort, wo uns're Ahnen liegen,
Steine sprechen, die nicht trügen,
liegt die Heimat, uns zu eigen
in der Schönheit buntem Reigen,
die uns ruft mit bangem Sehnen,
wo als Sklaven Deutsche stöhnen,
die für fremde Völker fröhnen,
die mit Hunger ihnen lohnen.
Doch es wird die Stunde schlagen,
wo man rufend uns wird sagen:
Kehrt zurück zum heim'schen Herde,
Euch verlangt die Heimaterde.
Müßt sie wieder Euch erringen,
jedes Opfer für sie bringen.
Dürft nicht wägen, dürft nicht zagen,
gilt es selbst, das Leben wagen!
Hebt die Hände, laßt uns schwören.
Unser muß die Heimat werden!
Rechten woll'n wir nicht, nicht richten.
Woll'n in Frieden alles schlichten.
Gönnt die Freiheit uns und Frieden,
jedem Volk zum Glück beschieden.
Nicht Vergeltung und nicht Rache
sei sudetendeutsche Sache.
Wir woll’n niemanden vertreiben,
doch was Recht ist, muß Recht bleiben!
Woll'n Gerechtigkeit nur haben,
nicht an fremdem Leid uns laben.
Wenn daheim wir wieder schaffen,
werden bald wir uns erraffen.
Aufbau'n, was sie uns zerstörten
und bereu'n als die Betörten.
Tief woll'n wir den Nacken beugen.
Ehre Gott dem Herrn bezeugen.
Durch die weite Welt soll klingen
unser Dank und Lobliedsingen.
Und der Eid, den wir gesprochen,
wird im Tod selbst nicht gebrochen!
So wahr uns Gott helfe!
Schlußbemerkungen
Mit zunehmendem Alter rücken die Erinnerungen an vergangene Zeiten und an die Kindheit immer mehr ins Bewußtsein. Doch nicht diese Tatsache war der Grund dafür, daß ich meine Erlebnisse, insbesondere die in den Jägerndorfer Lagern, zu Papier bringen wollte.
Ausschlaggebend war das Wiedersehen mit meiner Geburtsstadt Jägerndorf nach 47 Jahren. Erst, als ich nach so langer Zeit die Stätten meiner Kindheit wieder erblickte, tauchten neben Kindheitserinnerungen auch die bisher offensichtlich ins Unterbewußtsein verdrängten schrecklichen Erlebnisse in den Lagern aus jener Zeit wieder auf. Beim Anblick der einen oder anderen Straße, eines bestimmten Gebäudes oder Platzes, standen plötzlich wieder Bilder der Angst und des Schreckens vor meinem geistigen Auge. Ich durchlebte noch einmal die Zeit des Hungers, der Vertreibung, des ärmlichen Wiederanfangs in der neuen Heimat. Die Vergangenheit hatte mich eingeholt.
Da ich von mir selbst und meinem Leben berichte, ließen sich gewisse Emotionen nicht vermeiden. Während ich meine Erlebnisse zu Papier brachte, konnte ich mich immer mehr in meine Kindheit und in die damalige Zeit zurückversetzen. Ich war ein Kind wie jedes andere, mit bescheidenen Wünschen und Träumen, aber auch mit Gefühlen und Verstand. Meine junge Seele war nicht minder belastet als die der Erwachsenen, wenn es darum ging, Schläge und Demütigungen hinnehmen, Hunger und Not erleiden zu müssen.
Doch nicht nur triste Bilder drängten sich mir auf. In Gedanken kehrte ich zurück in die Tage meiner frühesten Kindheit, in eine von Bescheidenheit, zum Teil aber auch während der Vor- und Nachkriegswirren durch Not geprägten Zeit, und unwillkürlich verglich ich das Leben der heutigen Jugend mit dem meinen von damals. Ich bin in keiner Wohlstandsgesellschaft aufgewachsen, dennoch hatten sowohl meine Eltern, deren Stammbaum im Jägerndorfer Raum bis in das Jahr 1690 zurückverfolgt werden kann, als auch ich Zukunftspläne, die mit Sicherheit verwirklicht worden wären, hätten wir in unserer Heimat bleiben können.
Es soll noch einmal betont werden: Nicht den materiellen Gütern trauere ich nach, sondern dem wunderschönen Land, das einmal meine Heimat war und meine Zukunft werden sollte. Es tut weh, heute verwahrloste Städte und Dörfer sehen zu müssen, da, wo unsere Vorfahren über Jahrhunderte hinweg dank ihrer Hände Arbeit einen fruchtbaren Acker und eine blühende Industrie geschaffen hatten. Daß unser Sudetenland auch auf wissenschaftlichem und kulturellem Gebiet einen hohen Standard besaß, scheinen die heutigen Bewohner, die uns Sudetendeutschen gegenüber immer noch mit Abneigung, um nicht Haß zu sagen, begegnen, nicht mehr wissen zu wollen. Wir, die dort im Osten tiefe Wurzeln geschlagen hatten, hätten all diesen Reichtum und unser Kulturerbe noch vermehrt.
Wenn man - wie ich - Lagerleben und Vertreibung hinter sich, den Verlust der Heimat erlitten hat, und der Zukunftschancen beraubt worden ist, dann fällt es schwer, Verständnis für die Menschen, ob deutschstämmige oder Ausländer, und deren Ansprüche aufzubringen, die heute freiwillig in die Bundesrepublik strömen. Wir haben damals keine Forderungen hinsichtlich Unterkunft bzw. Wohnungsgröße, sanitärer Einrichtungen, neuer Kleidung, angemessener Verpflegung, finanzieller Unterstützung etc. gestellt. Wir waren froh und glücklich, ein Dach über dem Kopf und ein Stück Brot in der Hand zu haben. Das Bemühen unserer Eltern galt damals als erstes der Arbeitsuche. Wir wollten keine Almosen, sondern wieder auf eigenen Füßen stehen.
Wir, die wirklich Vertriebenen, waren dankbar und bescheiden. Zuviel hatten wir erdulden und erleiden müssen. Zunächst hatten wir eine Heimat gefunden, aber die Hoffnung auf eine Rückkehr in unser Sudetenland wollten wir nicht so schnell aufgeben. Das Leben ist anders verlaufen als wir es uns vorgestellt hatten. Die Hoffnung auf eine Rückkehr schwand von Jahr zu Jahr. Alles wurde uns genommen, doch das Bild der Heimat, welches wir in unseren Herzen tragen, kann uns niemand entreißen.
Eleonora Schwella
Karlsruhe, Dezember 1996
(Die im November 2003 herausgegebene 5. Auflage enthält einige Ergänzungen. Auf die veränderte politische Lage in der Tschechei, die mittlerweile erfolgten Renovierungs- und Wiederherstellungsarbeiten in verschiedenen Orten bin ich nicht eingegangen).
Anhang: Zur Geschichte der Stadt Jägerndorf
Jägerndorf liegt am Zusammenlauf der Flüsse Oppa und Goldoppa, zu Füßen von Hanselberg und Burgberg, den letzten Ausläufern des Niederen Gesenkes. Aufgrund archäologischer Funde konnte bewiesen werden, daß der Ort schon vor 30.000 Jahren, also bereits ab der älteren Steinzeit, ständig besiedelt war.
Das Entstehungsdatum Jägerndorfs läßt sich nicht eindeutig bestimmen. Am Orte einer slawischen Siedlung (Gebietsbezeichnung Kyrnow) wurde Jägerndorf zwischen 1240 und 1253 gegründet. Neben der - unmittelbar nach der deutschen Besiedlung erscheinenden - Bezeichnung „Jegerdorf“ findet sich im Mittelalter auch der latinisierte Name Carnovia.
Der Bereich unserer engeren Heimat gehörte zunächst zum Großmährischen Reich, später zum böhmischen Königtum der Přemysliden. Im Jahre 1377 entstand das Jägerndorfer Herzogtum, dem neben dem Stadtumland auch weite Gebiete nördlich und nordöstlich der Stadt angehörten. Hussitenkriege, der kriegerische Einfall des ungarischen Königs Corvinus (1474) und andere Auseinandersetzungen verursachten dem Land erheblichen Schaden. Der allgemeine Aufschwung setzte erst wieder mit der Regierungszeit des Markgrafen Georg von Ansbach-Brandenburg ab 1523 ein.
Auch der Dreißigjährige Krieg hinterließ seine Spuren in Stadt und Land. Weitere schwere Verluste erlitt Jägerndorf durch die Kriege von König Friedrich II. gegen Maria Theresia. Bereits der erste Krieg hatte zur Folge, daß der fruchtbarste Teil Schlesiens, als „Garten“ bezeichnet, an Preußen fiel, während der „Zaun“, also das schmale Altvatergebiet, bei Österreich verblieb.
Nach dem Ersten Schlesischen Krieg wurde Jägerndorf Grenzstadt (1742) und blieb dies mit Ausnahme der Zeit zwischen 1938 und 1945 bis heute.
Schon während des Mittelalters war Jägerndorf durch seine handerzeugte, später fabrikmäßige Herstellung von Textilien, besonders durch das Tuchmachergewerbe, bekannt, was der Stadt den Beinamen „Schlesisches Manchester“ einbrachte. Im 19. Jahrhundert entwickelte sich neben dem Maschinen- auch der Orgelbau. Rieger-Orgeln gingen in die ganze Welt.
1862 verfügte Jägerndorf bereits über eine Telegraphenstation. 1872 erfolgte der Ausbau des Eisenbahnnetzes; dadurch war Jägerndorf, das mittlerweile als moderne Industriestadt bezeichnet werden konnte, mit Olmütz, Troppau und Leobschütz verbunden. 1890 gab es den ersten Telephonverkehr. Mit der infrastrukturellen und wirtschaftlichen Entwicklung wuchs auch die Bevölkerungsdichte der Stadt. In den Jahren zwischen den beiden Weltkriegen zählte Jägerndorf ca. 26.000 Einwohner. Im gesamten Kreis Jägerndorf lebten 1939 etwa 65.000 Menschen, davon bis 1938 etwa 2.850 Tschechen (1910: im Kreis Jägerndorf nur 278 Tschechen). Wie die Zahlen beweisen, handelte es sich vor dem Ersten Weltkrieg um eine Stadt mit fast nur deutscher Bevölkerung.
Jägerndorf war nicht nur eine dicht bevölkerte Industriestadt mit der unter allen sudetendeutschen Städten größten Ausdehnung, sondern auch ein Kulturzentrum. Viele bildende Künstler, Schriftsteller, Dichter, Musiker und Architekten, deren Bedeutung die Grenzen der Stadt und der Region überschritt, hatten in Jägerndorf ihren Wohnsitz. Die Tradition der Jägerndorfer Sängerchöre und Orchester hat sich bis heute erhalten.
